 Religiöses Buch im Februar 2022
Religiöses Buch im Februar 2022
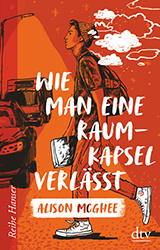
Aus d. Engl. v. Birgitt Kollmann.
dtv 2021
€
13,40.
Alison McGhee: Wie man eine Raumkapsel verlässt
Segen ist eine Zeichensetzung des Transzendenten – begrifflich abgleitet vom lateinischen signum für Zeichen, Abzeichen, Kennzeichen. Herbeigerufen wird mit dem Segen eine Kraft, die über das Rationale hinausweist. In fernöstlichen Kulturen ist dabei von einer lichtvollen, positiven Kraft die Rede. Im Christlichen von der göttlichen Gnade. Gebunden ist der Segen an ein Gebet oder einen Ritus und damit an bestimmte Sprachformeln und/oder Gesten/Gebärden.
Diesen formelhaften Charakter des Segens greift Alison McGhee in der Gestaltung ihres Jugendromans auf: Hundert Kapiteln wird ein chinesisches Zahlenzeichen vorangestellt. Gegenübergestellt der Erzähltext, der je Kapitel hundert Worte umfasst. (Grandioserweise ist es der Übersetzerin Birgit Kollmann gelungen, diese Wortanzahl ins Deutsche mitzunehmen.) Das Buch selbst scheint also aus hundert Zeichen und hundert Segensprüchen zu bestehen – und erzählt gleichermaßen davon.
Das Rituelle bekommt dabei im perpetuierten Aufrufen einzelner Handlungen oder Sprachformeln Bedeutung: Der 16-jährig Will setzt sein Erzählen ein mit den Worten „Echtes Maisbrot – hast du so eins schon mal gegessen?“ Er versucht sich immer wieder aufs Neue an diesem Maisbrot – und ruft dabei die Erinnerung an seinen Vater auf, der das vermeintlich perfekte Maisbrot backen konnte. Diese Erinnerung an den bereits vor einigen Jahren verstorbenen Vater ist an eine traumatische Erfahrung gebunden, von der nach und nach kleine Bruchstücke sichtbar werden. Um sich davon (innerlich) zu befreien, durchmisst Will gehend (im bundedeutschen: laufend) die eigene Umgebung und verortet sich damit auch neu im eigenen Leben.
Der Schmerz über den Verlust des Vaters ist gerade im Moment nochmals deutlicher präsent, weil Wills Kindheitsfreundin Playa Schreckliches widerfahren ist. Will war ebenfalls auf jener Party, hat sie aber früher verlassen. Die Frage ist weniger, ob er Playas Vergewaltigung hätte verhindern können. So wie es auch weniger die Frage ist, ob der Selbstmord seines Vaters hätte verhindert werden können. Vielmehr versucht Will sein eigenes emotionales Durchhalten in kleinen Gesten auf Playa zu übertragen.
„Kennst du sie, diese Vergewaltiger?“
Nein. Kenne ich nicht. Nicht wirklich.
Playa kenne ich. (S. 59)
„What I leave behind“ ist der Originaltitel des britischen Romans. Ich-Erzähler Will handelt nicht rückwärtsgewandt, sondern versucht seinem Gehen (wie Tamara Bach es am Ende von „Busfahrt mit Kuhn“ so schön formuliert hat) eine eigene Richtung zu geben. Denn vielfach erscheint er durch die Ereignisse (immer noch) emotional von der übrigen Welt abgetrennt. So als würde er in einer Raumkapsel durchs All schweben. Entlehnt ist dieses Bild (und damit auch der deutschsprachige Titel) David Bowies Song „Space Oddity“. Der Lieblingssong von Wills Vaters ist dem Roman als literarischer Soundtrack eingeschrieben und wird (auch das eines der angesprochenen Rituale) immer wieder aufgerufen. Als Major Tom lässt Will sich von der Ground Control anfunken – geht aber nicht im Weltall verloren wie sein Vater. Vielmehr läuft sein Erzählen darauf hinaus, die Raumkapsel zu verlassen und wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Er schafft, was sein Vater nicht geschafft hat.
Musik ist die Zuflucht der Einsamen, sagte mein Dad immer. Das, und auch:
Carry on, my wayward son.
Und: Don’t let the bastards get you down.
Seine innere Einsamkeit überwindet Will, indem er selbst zum Segensbringer wird – ganz im Sinne des lateinischen Wortes, das dem Akt des Segnens entspricht: benedicere, zusammengesetzt aus bene (gut) und dicere (sagen). Animiert wird er dazu durch ein kostbares Kästchen im Laden von Mr. Ling, das hundert Segensprüche enthält. Er deutet sie um in kleine Give Aways: An dieser Stelle kommt der ein-Dollar Shop ins Spiel, in dem Will jobbt. Den scheinbaren Ramsch, den er dort aus Kisten packt und in die Regale räumt, deutet er um und platziert die kleinen heilsbringenden Aufmerksamkeiten im Leben anderer. Auch in jenem von Playa.
Berührend und ausschnitthaft verknappt erzählt Alison McGhee damit von Möglichkeiten, das eigentlich Unaushaltbare auszuhalten, indem man einander Halt gibt. Ihr Kompositionsprinzip lehnt sie dabei an jene kostbaren Segenswünsche an, die im Laden von Mr. Lin beim Kauf einzeln in Seidenpapier verpackt werden. „What I Leave Behind“ is a novel in almost-verse, hält die Autorin selbst auf ihrer Homepage fest. Jedes Wort ist vor diesem Hintergrund kostbar – und wird von Will doch in heller Tonalität in sein pointiert-humorvoll durchsetztes Erzählen gewoben. Selbst Playa lässt sich dadurch wieder aus ihrem Schneckenhaus locken:
Don’t let the bastards get you down.
Heidi Lexe/Kathrin Wexberg
Wie sich der Roman in den Kontext anderer Versromane fügt, zeigt eine Themenliste auf der STUBE-Homepage. Zu finden >>> hier.
Der Frage, was unter einem literarischen Soundtrack verstanden werden und welche Formen und Funktionen er haben kann, widmet sich Heidi Lexe in einem Beitrag des Jahrbuchs der Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung zum Thema Klänge. Den Beitrag mit dem Titel „Seiten aufschlagen. Saiten anschlagen" findet man als Open Journal >>> hier.
>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2022
