 Religiöses Buch im Juni 2020
Religiöses Buch im Juni 2020
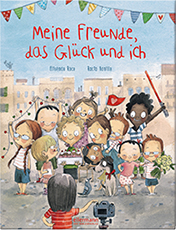
Aus dem Katalan. v. Ursula Bachhauser.
ellermann 2020. € 15,00.
Elisenda Roca und Rocio Bonilla: Meine Freunde, das Glück und ich.
Hallo! Ich bin Violetta. Gleich zu Beginn erfährt der Leser oder die Leserin so einiges über die Protagonistin, aus deren Sicht die Organisation eines Straßenfestes erzählt wird. Zum Beispiel was sie mag (Wörter, die wie Geräusche klingen) oder auch nicht mag (Tiere, die stechen) und dass ihr Hund Struppi heißt. Was die Lesenden aber nicht erfahren, ist, wie Violetta genau aussieht. Bis zur letzten Seite ist ihr Gesicht hinter Blumensträußen versteckt, sie wird von hinten gezeigt oder ist gar nicht im Bild. Stattdessen werden eine Reihe anderer Kinder in den buntesten Familienkonstellationen und die Berufe der Eltern vorgestellt. So organisieren die Kinder Blumen im Blumenladen, den Noras Mütter gemeinsam führen, holen Notenständer bei Landos Musikereltern und Beths Mutter verleiht die nötigen Tische und Sessel.
Im Text und in den farbenfrohen Illustrationen von Rocio Bonilla wird eine heterogene Kinderschar mit für die Illustratorin typischen großen Augen gezeigt, in der zahlreiche Ethnien vertreten sind und noch mehr: dank der unterschiedlichen Familiensituationen von der alleinerziehenden Mutter, über homosexuelle Paare und Patchworkfamilien wird aufgezeigt, wie plural die Gesellschaft nicht nur in Bezug auf die familiären Situationen sein kann. Nebenbei werden typische Geschlechterrollen aufgebrochen, wenn etwa Lundos Mutter zum Taktstock greift und nicht der Vater, dessen Gesicht über das ganze Buch hinweg nicht zu sehen ist.
Verwunderlich mag auf den ersten Blick wirken, dass Violetta auf der Textebene all ihre Freund*innen als ihre besten bezeichnet und auf jeder Seite darauf hingewiesen wird, welchen Unsinn Struppi gerade treibt. Dies erklärt sich schließlich auf der letzten Seite nach einem Gruppenbild, wo den Lesenden erstmals das Gesicht der Protagonistin gezeigt und klar wird, dass Violetta Trisomie 21 hat.
In diesem Bilderbuch wird lebhaft vorgeführt, wie eine transkulturelle Gesellschaft aussehen, wo jeder und jede anders sein kann, und dennoch seinen oder ihren Platz einnimmt. Erfreulich ist dabei, dass nicht mit der Moralkeule geschwungen, sondern Inklusion und Interkulturalität als ganz selbstverständlich dargestellt wird und es dafür keine besonderen Ereignisse braucht, sondern ein Straßenfest Erzählanlass genug ist. Mitunter bräuchte es einen, eine Spur weniger pädagogisierenden Ton, wenn auf die familiären Unterschiede hingewiesen wird.
Neben der Ausgewogenheit zwischen Freundinnen und Freunden und der pluralen Darstellung der Kinder und deren Eltern wird auch auf der grammatikalischen Ebene gegendert – ein Aspekt, der in Bilderbüchern und Büchern ganz allgemein nicht häufig auftritt.
Alexandra Hofer
>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2020
