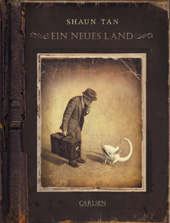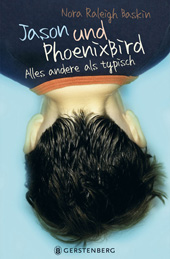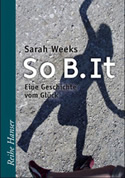Thema: Schweigen in der Kinder- und Jugendliteratur
Shaun Tan: Ein neues Land
Um das Fremdsein auszudrücken, braucht es keine Worte, denn ein Verständnis kann ohnehin nicht geschaffen werden. So erzählt diese textlose Graphic Novel die Geschichte einer Reise, wie sie Hoffnungssuchende in allen Ecken der Erde in jedem Moment antreten. Ein Mann verlässt seine Familie, seine Heimat, um anderswo sein Glück zu finden – eine Welt, die zunächst vor allem fremd und verwirrend ist. Die anmutige Sprache der Bilder, schwarz- weiß und sepia, erzählt in sequenziellen Bildfolgen von der Entfremdung, die hier eine Stilisierung zur Allgemeingültigkeit erfährt. Oft sind die Illustrationen nur Bruchteile von Sekunden versetzt und erfahren eine faszinierende Dynamisierung durch den Einsatz von filmischen Ausdrucksmitteln. Die Illustrationen sind geprägt von einem fotographischen Realismus, der als Paradoxon zu den teils surrealen und phantastischen Bildinhalten zu sehen ist, die doch wieder von Erfahrungen berichten, wie sie Menschen tagtäglich und weltweit machen. In seinen eindrucksvollen Bildwelten zeigt der australische Künstler Shaun Tan, dass textloses Erzählen alles andere als sprachlos ist.
Carlsen 2008.
128 S.
Nora Raleigh Baskin: Jason und PhoenixBird. Alles andere als typisch
ASD, NLD, PDD-NOS – mit diesen rätselhaften Buchstabenkombinationen versucht die klinische Diagnostik festzumachen, was an Jason, dem Ich-Erzähler dieses Jugendromans, anders ist: Eine Entwicklungsstörung aus dem autistischen Spektrum. Doch während seit Rain Man autistischen Menschen in der Populärkultur eher Begabungen im Bereich der Mathematik zugeschrieben werden, schreibt Jason Geschichten, die er anschließend auf eine Website stellt. Ein Mädchen mit dem Nickname Phoenixbird beginnt diese zu kommentieren. Während Jason im persönlichen Kontakt nicht in der Lage ist, Beziehungen aufzubauen, entspinnt sich zwischen den beiden ein reger Austausch. Doch als es zu einer realen Begegnung kommen könnte, gerät er in Panik. Jason reflektiert nicht nur sein Leben mit seinen Besonderheiten, sondern Literatur. Seine Geschichten spiegeln und verfremden Jasons Realität – doch wenn der kleinwüchsige Protagonist seiner Geschichte letzten Endes selbstbewusst zu sich und seinen Eigenheiten stehen kann, gilt das vielleicht auch ein kleine Stück für ihn selbst.
Aus dem Engl. v. Uwe-Michael Gutzschhahn.
Gerstenberg 2010.
224 S.
Sarah Weeks: So B. It. Eine Geschichte vom Glück
"Vielleicht bist du nach dem Buch benannt oder auch nach dem Film. Shirley Temple hat da mitgespielt." Doch alles, was Heidi über sich weiß, ist ihr Vorname. Ihre Nachbarin Bernadette, genannt Dette, hat das Mädchen einst als Baby im Arm ihrer geistig behinderten Mutter im Stiegenhaus gefunden; die Mutter konnte nur mit einem Satz über sich und ihr Kind Auskunft geben: So Be It. Diesem Fatalismus jedoch will Heidi nicht nachgeben. Als sich mit dem zufälligen Fund eines alten Fotoapparates erstmals ein Anknüpfungspunkt an die Vergangenheit der behinderten Frau ergibt, begibt Heidi sich neugierig, mutig und stur auf eine Reise, die sie weit überfordert und doch unumgänglich ist. Wie schon bei Johanna Spyri wird dabei ein geschlossener Handlungsraum (der hier durch die Sprachlosigkeit der Mutter und die Agoraphobie von Dette bis hin zur Skurrilität gesteigert wird) einem fremden, offenen gegenübergestellt, indem Heidi sich erst in ganz basalen Alltagsvollzügen zu Recht finden muss. Entstanden ist daraus ein lakonisch erzählter Kinderroman, der gerade in seinem Konstruktcharakter ständig zu überraschen weiß. Denn orientiert sind Rhythmus und Dynamik des Geschehens dabei an den wenigen Worten, die Heidis Mutter zu sagen im Stande ist – darunter das geheimnisvolle "Soof", dessen Bedeutung Heidi und Dette nie klären konnten.
Aus dem Engl. v. Brigitte Jakobeit.
dtv 2007.
224 S.

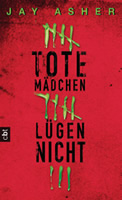
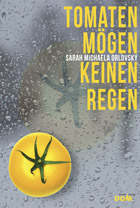
Kathrin Schrocke: Freak City
"Ich sehe, dass du denkst. Ich denke, dass du fühlst. Ich fühle, dass du willst, aber ich hör dich nicht." Die deutsche Band "Wir sind Helden" steuert mit diesen Lyrics sowohl den Soundtrack einer jungen Liebe als auch den Leitgedanken dieses Adoleszenzromans bei: "Freak City" ist jene soziale Einrichtung für Jugendliche, in der Mika auf die gehörlose Lea trifft. Beiden fehlt anfangs nicht nur eine gemeinsame Sprache, sondern auch der Mut sich einander zu nähern. Die Nutzung verschiedenster Medien, nicht zuletzt der Gebärdensprache, die Mika für Lea lernt, ergibt eine sehr vielfältige Dialogizität, die die beiden schließlich einem Happy End und die Lesenden der gemeinsamen Schnittmenge beider Sinneswelten näher bringt.
Sauerländer 2010.
184 S.
Jay Asher: Tote Mädchen lügen nicht
13 Gründe warum sich die Highschool-Schülerin Hannah das Leben genommen hat, 13 Personen, die daran beteiligt waren. Für jede/n von ihnen hat sie vor ihrem Tod eine Kassettenseite besprochen und mit der Auflage ergänzt, das Paket nach dem Hören an das nächste Glied der Kette weiterzugeben. Als Erzählinstanzen fungieren sowohl Hannah als auch ihr Mitschüler Clay, der ihre Worte, die bei seiner Wanderung an Orten der Erinnerung durch die Kopfhörer schallen, reflektiert. Das analoge Moment der altmodischen Kassetten korrespondiert hier ganz mit der Chronologie der Ereignisse: Nur auf einem analogen Medium kann die Kette von Schuld erzählt werden. Hannahs Ohnmächtigkeit sich anderen mitzuteilen wird erst nach ihren Entschluss zum Suizid überwinden – ihre letzten Worte werden zum bitteren Nachlass, der zwar erklären, aber nicht mehr retten kann.
Aus dem Engl. v. Knut Krüger.
cbt 2009.
288 S.
Sarah Orlovský: Tomaten mögen keinen Regen
"Das Haus "Betlehem" ist ein besonderes Zuhause für besondere Kinder." So formuliert es Ana, die eine "Behinderten-Story" über ein Waisenheim schreiben möchte. "Ein Waisenheim ist halt ein Waisenheim." So sieht die schlichte Lebensrealität für die Bewohner*innen aus – etwa für Ich-Erzähler Hovanes, der unmittelbar Einblicke in seine jugendliche Gefühlswelt erlaubt. Er trägt schwer am Bewusstsein, "anders" zu sein, sein Wunsch nach Selbstbestimmung ist kaum zu verwirklichen. Trotz des hermetischen Schauplatzes wird Diversität transportiert und das Heim als komplexes Kollektiv dargestellt. Die dramaturgische Konzeption steht der psychologischen Stimmigkeit um nichts nach: Eine weitere Erzählinstanz lässt erahnen, dass Hovanes Konflikte (letztlich mit sich selbst) in einem gefährlichen Ereignis münden.
Wiener Dom-Verlag/Tyrolia 2013.
192 S.
Sharon M. Draper: Mit Worten kann ich fliegen
Mit angemessenem Pathos wird hier eine außergewöhnliche Ich-Erzählerin etabliert: Melody leidet an Zerebralparese; sie kann nicht selbst essen und nicht sprechen, ist aber – ganz wie ihr großes Vorbild Stephen Hawking – ein kluger Kopf. Nach außen hin jedoch macht sich nicht ihr reger Geist, sondern ihr Zucken und Toben bemerkbar. Ihre Sprachkenntnis ist viel weiter fortgeschritten als jene vieler Gleichaltriger – doch es bedarf im traditionellen Bildungssystem erst der Handlungskompetenz von Entscheidungsträger*innen, um Melody zu integrieren – und sie mit einem Sprachcomputer fit für die Regelschule zu machen. Der Roman folgt Melodys Gedanken, deutet ihre Handlungen aus und zeigt die Höhen und Tiefen im Leben eines Mädchens, das sich nicht daran hindern lassen will, am Schulquiz teilzunehmen. Aber nicht immer ist das Leben ein Wunschkonzert …
Aus dem Amerikan. von Silvia Schröer.
Ueberreuter 2014
317 S.
Kirsten Boie: Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen
45 Prozent aller Kinder in Swasiland sind Waisen. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Land beträgt nur 31 Jahre. Kirsten Boie hat vier Geschichten über Kinder aufgeschrieben, die in diesem südafrikanischen Land auf sich allein gestellt aufwachsen und damit kindliche Autonomie im heftigsten und schlimmsten Sinne leben müssen: Thulani könnte eigentlich zur Schule gehen, denn für Vollwaisen ist sie kostenlos. Aber niemand hilft ihm, den Totenschein auszustellen. Jabu, Lungiles kleine Schwester braucht neue Schuhe, um die Schule besuchen zu dürfen. Um dafür aufkommen zu können, verkauft Lungile ihren Körper. Was die Zukunft für die Kinder bringen wird, bleibt offen. Ebenso wie der Ausgang des medizinischen HIV-Tests, dem sich die Schwestern Sonto und Pholile tapfer stellen. Für die eindrücklichen Momente hat Boie nur wenige Worte gewählt und zurückhaltend erzählt. Kräftige Bilder ohne folkloristische Überzeichnung von Regina Kehn vervollständigen das Projekt, das in seinem Respekt gegenüber dem Leben anderer bei gleichzeitiger Anklage gegen die gesellschaftlichen Zustände einzigartig scheint.
Oetinger 2013.
111 S.



JonArno Lawson und Sydney Smith: Überall Blumen
Ein Bilderbuch für Florist*innen? Nein, aber auch blumenaffine Leser*innen werden ihre Freude an diesem quadratischen Buch haben, das doppelseitige Illustrationen und filmische Perspektiven ebenso einzusetzen weiß wie eine klare Panelstruktur. Ein ästhetischer Anspruch wird aber auch durch das Farbkonzept verfolgt, das ein rotbejacktes Mädchen in eine schwarz-weiße Stadtlandschaft setzt. Kontrastive Farbakzente entstehen in Folge aber auch durch die vielen bunten, vereinzelt auftauchenden Blumen, die ihren Platz in der Betonwüste beanspruchen können und von der emsigen Protagonistin in Begleitung ihres Vaters eingesammelt werden. Textlos und doch angeregt von den artifiziellen Illustrationen begleitet man das Mädchen durch die Stadt und erhält schließlich viel Interpretationsspielraum, als das Mädchen der grauen Stadt auf liebenswürdige Weise und mit Hilfe der gesammelten Blumen Leben einhaucht.
Fischer Sauerländer 2016.
24 S.
Thé Tjong-Khing: Kunst mit Torte
Munch, Picasso, Thé Tjong-Khing. Mit seinem aktuellen Bilderbuch schreibt beziehungsweise zeichnet sich der Illustrator in die oberste Liga der Kunstgeschichte ein, indem er seine witzige wie spannende Suchbilderbuchkunst in ein Kunstsuchbilderbuch verwandelt und die Figuren durch riesige Gemälde von Dalí, van Gogh, Kandinsky und Konsort*innen jagt. Auf breitformatigen, farbenfrohen Doppelseiten, auf denen es wie immer viel zu entdecken gibt, entsteht ein großes, eigenständiges Kunstwerk, in dem die Protagonist*innen zum Beispiel aus Munchs „Schrei“- Szenerie an Henri de Toulouse-Lautrec höchstpersönlich und einem mit Keith-Haring-Vorhängen bestückten Mondrian-Gemälde vorbeilaufen, um schließlich zu einer Edward-Hopper-Tankstelle zu gelangen. Thé Tjong-Khing schafft Kunst in Kunst in Kunst in Kunst… und somit ein Meta-Kunstbilderbuch für alle, die Kunst bereits lieben oder nach der Lektüre lieben werden.
Moritz 2017.
13 S.
Einar Turkowski: Als die Häuser heimwärts schwebten
Mit bewährt schwarzem (Bleistift-) Strich auf weißem Untergrund entwirft der preisgekrönte Künstler Einar Turkowski auch in diesem Buch wieder fantastische Welten voller magischer Details. Es sind insgesamt zehn Erzählbilder, die jeweils zwei Gegensätze visualisieren und dabei völlig textlos auskommen. Es gilt genau hinzusehen, Einzelheiten zu entdecken und Eigenes sowie Fremdes zu erforschen – es sind Aufforderungen zum (Weiter-) Erzählen und Weiterspinnen der Bildideen, zum Fabulieren und Hinterfragen. Welche Geschichten sich hinter den Illustrationen verbergen, wird an keiner Stelle vorgegeben. Das eigenständige Denken ist gefragt! Dessen Notwendigkeit und Wirkung rühmt auch Dr. Kristina Calvert, Kinderphilosophin, Dozentin und Autorin, im Nachwort. Es gibt kein richtig und kein falsch – nur ein Staunen und Wundern, ein gemeinsames Entdecken und Ausformulieren! Auch die schwarz-weiße Reduktion entspricht dem Anspruch dieses Bilderbuches: Sogar die Farben dürfen Leser*innen sich hier selbst erträumen und damit dem Buch den finalen eigenen Anstrich verpassen.
mixtvision 2012.
30 S.