 Religiöses Buch im Juni 2023
Religiöses Buch im Juni 2023
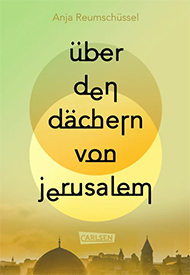
Carlsen 2023.
336 S.
Anja Reumschüsssel: Über den Dächern von Jerusalem
Der Nahost-Konflikt: Eine andauernde Auseinandersetzung, die 1948 und somit nicht lange nach dem Ende des zweiten Weltkriegs ihren Anfang nahm. Was der Auslöser war, ist heute mitunter nicht mehr allzu präsent. Und Anja Reumschüssel wirkt mit ihrem Romandebüt genau diesem Umstand entgegen.
1947: Das jüdische Mädchen Tessa hat in Deutschland das Konzentrationslager der Nationalsozialist*innen überlebt; ihre Mutter und ihr Bruder ermordet, bleibt ihr nach einiger Zeit im DP-Camp (Displaced Persons-Camp) die Möglichkeit nach Israel zu reisen, wo ihr Vater lebt, um endlich in Frieden und ohne Angst vor Verfolgung aufgrund ihrer Religion zu leben. Dort lebt aber auch Mo, ein muslimischer Junge, dessen Vater 1946 beim Anschlag auf das King David Hotel in Jerusalem getötet wurde und der fortan als Oberhaupt seiner Familie agieren muss.
Der Anschlag auf das Hotel ist dabei nur eine von vielen faktualen Einschreibungen, mit denen die Autorin ihren Jugendroman in die politische Situation auf den beiden erzählten Zeitebenen, 1947 und 2023, einbettet. Dieserart schafft sie Anhaltspunkte, die verdeutlichen, wie lange dieser Konflikt bereits andauert. Dabei gelingt Anja Reumschüssel, die als Journalistin einige Jahre in Israel gelebt und recherchiert hat, eine ausgewogene wie neutrale Darstellung, aus insgesamt vier Perspektiven auf zwei Zeitebenen erzählt.
Da sind also Tessa und Mo, die sich 1947 zufällig auf einem Dach der Jerusalemer Altstadt kennenlernen. Ein Jahr nach dem Anschlag auf das Hotel findet Tessa keineswegs den Frieden, den sie nach dem Naziregime in Deutschland so bitter notwendig hätte. Tessas Vater ist Teil einer Widerstandsbewegung auf jüdischer Seite genauso wie Mo auf arabischer. Sie selbst arbeitet, um ihren Beitrag zur Errichtung eines „Jüdischen Staates“ beizutragen, in einem Kloster, wo sie Verwundete verarztet: unter denen eines Tages auch Mo ist. Und auch wenn sich die Wege der beiden Figuren immer wieder trennen, bleibt das Dach, auf dem sie sich kennengelernt haben, der Ort, an dem sich eine vorsichtige Freundschaft entspinnt. In den gemeinsamen Gesprächen zeigen sich die Lager, Ideologien und Religionen, in denen sie verortet und sozialisiert sind, wenngleich sie versuchen, den Konflikt „ihrer Völker“ außen vorzulassen. Es gelingt ihnen nur bedingt. Insbesondere dann, als der Staat Israel ausgerufen wird und es zur Trennung von Palästina und Israel kommt.
»Das ist nicht mehr Palästina, das ist jetzt Israel.«
»Toll, und was bin ich dann? Israeli?«
»Was warst du denn vorher? Palästinenser?«
»Ich bin einfach ein Araber. Nee, einfach ein Mensch. Wegen der Frage, wer zu welchem Volk gehört, schlagen wir uns auf der ganzen Welt die Köpfe ein. Das ist doch dumm!«
Und auch 2023 und somit 75 Jahre später schlagen wir uns auf der ganzen Welt die Köpfe ein. Es treffen im Westjordanland aber auch Anat, die gerade ihren Wehrdienst bei der israelischen Armee angetreten hat, und der etwas jüngere Karim aufeinander. Wie schon Tessa und Mo ist es eine Zufallsbekanntschaft, die sich später zu einer besonderen Verbundenheit entwickeln wird, durch und wegen der man sich gegenseitig rettet. Sie lebt als Jüdin in Jerusalem; er als Moslem in einem Flüchtlingslager in Palästina. Auf der zweiten Zeitebene sind es nicht mehr der Anschlag auf das Hotel sowie die Ausrufung Israels als eigenständiger Staat, die die beiden Protagonist*innen, aus deren Perspektive abwechselnd erzählt, beschäftigt, aber sehr wohl die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Völkern, die immer noch andauern und ihre Leben unterschiedlich und doch maßgeblich dominiert. Anats Mutter bekleidet eine hochrangige Funktion in der israelischen Armee; schon allein deswegen vertritt Anat eine klare Israelpolitik. Karim hingegen schleudert Steine auf die Türme der Checkpoints. Trotz dieser unterschiedlichen Verortungen fällt es bei den zufälligen Begegnungen und in der nunmehr übernächsten Generation nach Tessa und Mo leichter, Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren, auch wenn keine Lösung dafür gefunden werden kann.
Aufrüttelnd und ehrlich mit der nötigen Menge an drastischen Ausformulierung des Konflikts zeichnet Reumschüssel Erfahrungen in unterschiedlichen Generationen. Dass Tessa und Mo sich als die Großeltern von Anat und Karim herausstellen, ist dabei ein gekonnter Kniff, der die beiden Zeitebenen miteinander verbindet, aber ganz ohne verkitschtes Wiedersehen auskommt. Religiöse wie kulturelle Verortungen der Figuren in Judentum und Islam zeigen die Lebensrealitäten in Israel und zeugen von unterschiedlichen biografischen Einschreibungen. So zeigt sich die Dauer des Konflikts und sensibilisiert auf besondere Weise, wie die literarische Thematisierung eines komplexen politischen Konflikts gelingen kann.
Alexandra Hofer
.
Die gesammelten Religiösen Bücher des Monats finden Sie im
>>> Archiv
