 Religiöses Buch im April 2022
Religiöses Buch im April 2022
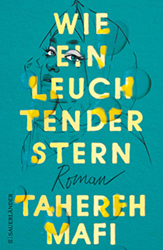
Aus. d. Amerikan. v. Henriette Zeltner-Shane.
Sauerländer 2022.
288 S.
Tahereh Mafi: Wie ein leuchtender Stern.
Nach zwei Jahren Panik und Trauer in der Folge des elften Septembers hatte unser Land sich zu aggressivem politischen Handeln entschlossen: Wir hatten dem Irak den Krieg erklärt.
2003: Shadi lebt mit ihrer zerrütteten Familie in einer kleinen US-amerikanischen Stadt. Der Bruder tot, der Vater im Krankenhaus, die Mutter ohnmächtig und mit ihrer Schwester im ewigen Streit. So skizziert Tahereh Mafi die Familie ihrer Ich-Erzählerin, in deren Leben kein Platz für jugendlichen Leichtsinn ist. Eine Ich-Erzählerin, die einst eine starke, selbstbestimmte junge Frau mit ausgezeichneten Noten und starken Überzeugungen war; deren Selbstsicherheit aber zunehmend ins Wanken gerät. Erzählt wird dabei auf zwei Zeitebenen: Kapitel aus dem Dezember 2003 wechseln sich mit jenen ab, die mit Letztes Jahr TEIL I–IV übertitelt werden. Der Tod ihres Bruders Mehdi steht dabei wie eine Bruchlinie dazwischen. Dieserart wird vor und zurückerzählt und so der Grund der inneren Zerrissenheit der Figur nachgezeichnet.
Verortet wird der Text dabei nahezu gänzlich in einer muslimischen Community. Anders als im letzten Roman der Autorin „Wie du mich siehst“ kommt es durch den Love interest nicht zu einem interkulturellen Dialog; vielmehr wird anhand von Ali – jenem Junge, in den sie sich verliebt – die Heterogenität ihrer Gesellschaft und zugleich die mitunter vorherrschende Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Muslim*innen-Dasein aufgezeigt:
Mehdi war drei Jahre älter als Ali gewesen, und beide hatten ein Leben geführt, wie es für Jungs üblich gewesen war. Ali und Mehdi hatten zu dieser besonderen Sorte attraktiver muslimische Teenager gehört, die sich nur sehr gelegentlich in der Moschee blicken ließen. […] Sie fanden Religion gleichermaßen verlockend wie lächerlich und waren sich in Bezug auf Gott im Allgemeinen unsicher. Aber gerade diese fehlenden feste Überzeugung machte es ihnen leichter, sich zu assimilieren – es ermöglichte ihnen, zu vielen Gruppen zu gehören statt nur zu einer einzigen.
Shadi reflektiert in Aussagen wie diesen nicht nur ihre eigene Religiosität, sondern bezieht auch kritisch dazu Stellung, inwieweit das Tragen eines Kopftuchs sie als Außenseiterin und zu einer dezidierten Religion gehörig markieren.
Die Autorin siedelt ihren Text im Jahr 2003 an und schafft so eine zeithistorische Einschreibung, die an ihre Biografie sowie die Wahrnehmung des Hidschabs in den USA nach 9/11 gekoppelt ist. Damit schließt sie zeitlich an den Vorgängerroman „Wie du mich siehst“ an und fügt der Sensibilisierung für jugendliche Figuren mit Hidschab in der Jugendliteratur ein Stück hinzu. Dies gelingt durch die Innenperspektive der Protagonistin mit einem persönlich, ehrlichen Blick auf die Wahrnehmung ihres Umfelds, ohne den Zeigefinger zu erheben und ohne zu schönen:
Terror
Er verfolgte mich, quälte mich, Terror, terrorisierend, Terrorist, Terrorismus, so lautet meine Definition gemäß Wörterbuch. Abgesehen von meinem Gesicht, Nach- und Vorname sowie dem Geburtsdatum.
Abseits von Anfeindung, Rassismus und Ausgrenzung sowie gesellschaftspolitischen Themen, die Tahereh Mafi anhand ihrer Protagonistin aufzeigt, dominieren die innere Zerrissenheit, Ängste sowie Hoffnungslosigkeit Shadis den Plot: die Trauer um ihren Bruder Mehdi mischt sich mit Wut gegen ihren Vater – dem sie die Schuld am Tod ihres Bruders gibt und dem sie selbst den Tod an den Hals wünscht – und Sorge um ihre Mutter, die ohnmächtig und depressiv außer Stande scheint, ihr Leben zu bewältigen. Hinzu kommt die Liebe zu Ali, mit dem sie nicht zusammen sein soll, kann, darf. Bruchstückhaft erfahren die Leser*innen wie es zur Annäherung der beiden vor dem Tod ihres Bruders kam und über die Rolle von Alis Schwester, die chronisch eifersüchtig ist und mit der sie in einer nahezu toxischen Freundschaft verbunden war. Entlang dieses emotionalen Ballasts dominiert in der Tonalität, die dem Roman innewohnt, die Frage nach dem Weitermachen, dem Wiederfinden, dem Nicht-Aufgeben.
Indes spielt die Rolle des Islams als gelebte Religion lange Zeit kaum eine Rolle, bis die Autorin ihre Protagonistin gegen Ende des Textes in einen gestärkten Glauben einbettet, der durch die Schicksalsschläge ins Wanken geriet und erst wieder gefestigt werden musste.
Bei all dieser Problemaufladung hat der Text keinen Anspruch auf ein Happy End; vielmehr steht am Ende eine jugendliche Figur, die nicht wieder heil ist, sondern immer noch von Emotionen und Ereignissen gebeutelt wird, deren Leben aber – vor allem auch durch Ali – langsam wieder in ein Gleichgewicht zu geraten scheint: Ich wusste nicht, wie ich mit der Gestalt von Hoffnung umgehen sollte.
Alexandra Hofer
>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2022
