 Religiöses Buch im Dezember 2021
Religiöses Buch im Dezember 2021
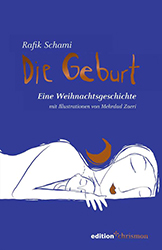
edition chrismon
2021.
65 S. € 14,40.
Rafik Schami und Mehrdad Zaeri: Die Geburt. Eine Weihnachtsgeschichte
Es war
oder es war nicht eine Frau
namens Mariam Aladra.
In ihrer mit „Die Geburt“ betitelten Weihnachtsgeschichte folgen Rafik Schami und Mehrdad Zaeri den Spuren jener Erzählung, die vielerorts am 24. Tag des Monats Dezember verlesen wird. Diese wird von den zwei namhaften Künstlern jedoch nicht einfach modernisiert; vielmehr eröffnen die beiden aus dem arabischen Raum stammenden und seit vielen Jahren in Deutschland lebenden Buchschaffenden in ihrem illustrierten Buch vielschichtige (Be-)Deutungsmöglichkeiten einer über mehrere Jahrhunderte, verschiedene Kulturkreise und unterschiedliche Erzähltraditionen hinweg tradierten Geschichte.
In den Worten Rafik Schamis folgen wir Mariam Aladra, die aus dem Westjordanland stammt und in Heidelberg Philosophie und Geschichte studiert, um später in ihrer Heimatstadt Bir Sait Geschichte zu unterrichten. Obwohl das Geld in Deutschland knapp ist, schickt sie Monat für Monat einen kleinen Teil ihres Stipendiums an ihren Mann Ruh Elkudus, der sich damit eine kleine Werkstatt einrichten kann. Nach einem ihrer regelmäßigen Besuche in Bir Sait, stellt Mariam schließlich fest: Sie erwartet ein Kind. Als sie eines Abends bei Ruhs Cousin, Jusuf Alnadschar, zu Gast ist, spürt sie plötzlich einen stechenden und ziehenden Schmerz im Unterleib. Überstürzt brechen Mariam, Jusuf und dessen Partnerin Claire auf, aber weit kommen sie nicht.
„Halt an, das Kind kommt“ […].
„Lass die Warnblinkanlage an“ […].
„Im Kofferraum ist eine Decke“ […].
Nachdem sich der völlig zerstreute Jusuf zu allem Überfluss auch noch seinen Kopf an der Kofferraumhaube blutig gestoßen hat, läuft er zum nächstgelegenen Haus, um die Anwohner*innen um Unterstützung zu bitten. Auf seinen Hilferuf reagieren zunächst eine Eritreerin, eine Vietnamesin und eine Rumänin, auf die bald deren Männer und Kinder folgen. Zu der immer größer werdenden Gruppe von Menschen aus aller Welt stoßen schließlich auch ein Landstreicher mit seinem Hund und zwei Polizisten, die beim Anblick der Ausländer zunächst stutzen, sich dann aber in das freudvolle Beisammensein unter einer Brücke irgendwo auf der Landstraße zwischen Fletschburg und Mannheim einfügen.
In leichtfüßigem, durchaus auch humorvollem Stil erzählt der gerne als begnadeter Geschichtenerzähler und Meister des Fabulierens bezeichnete Rafik Schami (eigentlich Suheil Fadel) die uns bekannte Weihnachtsgeschichte neu — und flicht dabei vielstimmige gesellschaftskritische Töne mit ein. Sei es in der starken, selbstbestimmten und selbstständigen Frauenfigur, die er mit Mariam Aladra entwirft, oder in seinem interkulturellen Gegenentwurf zu jener Darstellung, die vielerorts unsere Vorstellungen von den biblischen in Bethlehem zusammenkommenden Charakteren prägt. Unbeschwert spielt der syrisch-deutsche Autor mit gängigen Bildern, verschiebt diese bedeutungsvoll – aber nur so weit, dass weiterhin die zentralen Elemente der Erzählung durchschimmern.
Als ebenso unbeschwert und zugleich vielgestaltig erweisen sich die Illustrationen von Mehrdad Zaeri, dessen charakteristische Strichführung in den ausschließlich in Dunkelblau und Weiß gehaltenen Bildern deutlich wird. Zarte Motive und kleine Details erweitern den Text und dessen Neuschreibung der Weihnachtsgeschichte. So erzählen beispielsweise jene Vögel, die eine fragile aber bestimmte Verbindungslinie zwischen Deutschland und dem Westjordanland ziehen, von Mariams Sehnsucht nach ihrem Geburtsort und ihrer Familie. Und kleine Krönchen auf den Köpfen der vielfältigen Gesellschaft rund um das Neugeborene und dessen Mutter deuten ein subversives Spiel mit etablierten Motiven an, das auch der iranisch-deutsche Illustrator in seinen Bildern weiterführt.
Der Geschichte der Herbergssuche werden dabei Themen der Migration, des Lebensalltags in der Diaspora und der gesellschaftlichen Diversität ebenso eingeschrieben wie interreligiöse Verbindungslinien geknüpft. Diese scheinen nicht nur oberflächlich in der geografischen Verortung der Figuren oder dem Klang deren Namen auf, sondern prägen auch die Tiefenstruktur des Buches. Es lohnt sich daher durchaus, auch einen zweiten Blick auf die Namen der vorkommenden Figuren und Orte zu werfen: Während Mariam Aladra an die arabische Bezeichnung Maryam al-aḏrā (was so viel wie Jungfrau Maria bedeutet) erinnert, kann Ruh Elkudus mit der arabischen Phrase „Ruh al-qudus“ (die die muslimische Interpretation des Heiligen Geistes bezeichnet) in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig verweist Bir Sait nicht nur auf eine wichtige Universitätsstadt im Westjordanland, sondern auch auf jenen Ort, aus dem die nach „Tausendundeine Nacht“ wohl umfangreichste arabische Märchensammlung, die „Volkserzählungen aus Palästina, gesammelt bei den Bauern von Bīr Zēt“, stammt.
Und auch in der vorliegenden Geschichte spielt das Geschichte(n)erzählen immer wieder eine zentrale Rolle. Aber das ist – wie Rafik Schami sagen bzw. schreiben würde – eine andere Geschichte …
Claudia Sackl
>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2021
