 Religiöses Buch im Mai 2021
Religiöses Buch im Mai 2021
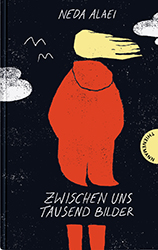
Aus d. Norweg. v. Stefan Pluschkat.
Thienemann 2021.
€ 14, 90.
Neda Alaei: Zwischen uns tausend Bilder
Ich vermisse Mamas Pfannkuchen, Sonntage vorm Fernseher, Sommertage im Park, Softeis vom Kiosk und Seilspringen. Ich vermisse es, Bücher zu lesen, Kakao mit Sahne zu bekommen und mich in einem nach Weichspüler duftenden Pyjama in frische Bettwäsche einzukuscheln.
[…]
Ich vermisse Pausenbrote und Wandertouren mit Thermoskanne, ich vermisse Wollsocken, Handschuhe und Schals. Ich vermisse das Gehen in der Zweierreihe, ich vermisse es Kieselsteine und Tannenzapfen vor mir herzukicken, ich vermisse nasse Gummistiefel und Hotdogs mit Ketchup.
[…]
Ich vermisse Mie.
Ich vermisse Yousef.
Ich vermisse Mama.
Ich vermisse Papa.
Ich vermisse es, zu fotografieren.
In einem der letzten Kapitel in Neda Alaeis Debutroman „Zwischen uns tausend Bilder“ schreibt Sanna, die 14-jährige Protagonistin alles nieder, was sie in ihrem Leben vermisst. Nämlich nicht nur ihre Mutter, die vor einem Jahr gestorben ist. Und auch nicht nur ihren Vater, der seither in seiner eigenen Welt gefangen ist, in einer tiefen Depression steckt und sich weder um seine Tochter, noch um irgendetwas im Haushalt kümmern kann. Sondern auch alles, was vorher war, was dazwischen liegt und einst Familie bedeutete.
In einem dichten, aber dennoch recht leicht zu lesenden Text erzählt die norwegische Autorin von einer jugendlichen Figur, die sich ausschließlich von Kaffee zu ernähren scheint und von einer Leere, wenn das Leben auseinander zu brechen droht. Der Tod und die Trauer um die Mutter nehmen dabei überraschend wenig Raum ein. Vielmehr die Erinnerung an die Lebenssicht der Mutter: Ich will, dass du die Welt siehst. Und dich an sie erinnerst (S. 35), sind jene Worte, die der Tochter für das Leben mitgegeben wurden. Worte, die umso mehr Bedeutung erhalten, als Sanna das geplante Geburtstagsgeschenk ihrer Mutter an sie findet: Eine Kamera. Diese Kamera wird es auch sein, die für die Protagonistin das Medium ist, sich ein Stück weit mit der Trauer auseinanderzusetzen und einen Schritt zurück ins echte Leben zu wagen. Zur Seite gestellt wird ihr Yousuf, der Neue in der Klasse, fotoaffin und gutaussehend. Das Fotografieren mit dem Geschenk der Mutter fällt Sanna nicht leicht, sie verwehrt sich vielmehr und kann nur durch einen Kniff von Yousuf und einer Einwegkamera gelöst werden; abwechselnd schießen die beiden Fotos von alltäglichen Dingen. Dabei fokussiert die Autorin nicht nur auf eine Welt, die durch den Sucher der Kamera gesehen werden kann, sondern ebenso auf die Geräuschkulisse, die dieses Welt(wieder)entdecken mit sich bringt. Das Sehen und Hören sind jene beiden Sinneswahrnehmungen, mit denen sich Sanna ihr Leben ein Stück weit zurückholen kann. Bezüglich des Hörens nimmt auch Kent, eine schwedische Band, die im skandinavischen Raum große Erfolge feierte, großen Raum ein. 2016 löste sie sich auf, wird in diesem Jugendroman aber wieder zum Leben erweckt. Und Kent ist auch jene Band, die Sanna an die Zeit vor dem Verlust erinnert.
Durch das Musikhören und das Fotografieren gelingt es Sanna zumindest nach außen ein Bild einer funktionierenden Jugendlichen zu zeigen. Wie es Innen aussieht, wird auch durch die oben zitierte Stelle deutlich.
Erst mit der Zeit werden die Bewältigungsstrategien, wie sie mit dem Tod der Mutter umgehen können (oder wie in Sannas Vater eben auch nicht) herausgestrichen. Während Sanna als eine Figur gezeichnet wird, die jegliche Verantwortung für sich selbst, aber auch Zuhause übernehmen muss – was ihr zu Beginn auch gelingt – ist es der Vater, der letztendlich in psychiatrischer Behandlung landet, um dort sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.
Authentisch zeigt die norwegische Autorin in ihrem Text auf, wie unterschiedliche Trauerbewältigung von statten gehen und diese gelingen kann. Dabei wird nicht pädagogisiert, sondern vielmehr verdeutlicht, dass es nicht einen richtigen Weg dafür gibt.
Alexandra Hofer
>>> hier geht es zu den Religiösen Büchern 2021
