 Religiöses Buch im Mai 2014
Religiöses Buch im Mai 2014
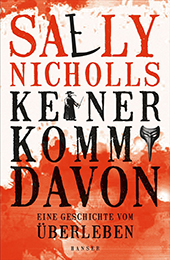
Sally Nicholls: Keiner kommt davon. Eine Geschichte vom Überleben. Aus dem Englischen von Beate Schäfer Berlin:Hanser 2014.
Was wir in unserer Zeit und im Rückblick auf die Ereignisse von 1347 bis 1353 als „Pandemie“ bezeichnen, nannte die betroffene Bevölkerung Europas selbst das „große Sterben“. Beide Begriffe für die Pestwelle des Mittelalters weichen im Grad ihrer Emotionalität stark voneinander ab, vernachlässigen aber beide die Millionen von Einzelschicksalen, die dahinter stehen. Mit ihrem historischen Roman versucht Sally Nicholls diese epochale Tragödie in ihrer ganz individuellen und subjektiven Wirkung nachzuvollziehen; dem Tod Gesichter zu geben und die nüchterne Distanz zu jenen Ereignissen zu brechen.
„Im Jahr des Herrn 1348 änderten sich die Geschichten“, heißt es zu Beginn des Textes und schon rollen die Gerüchte über seltsame Vorkommnisse in weit entfernten Ländern, über eine Krankheit, die keine Menschenseele am Leben lässt, heran. „Schon damals wussten wir, das Jahr 1349 würde entsetzlich werden. Aber wie groß das Entsetzen wäre, konnte sich keiner von uns ausmalen.“ Sally Nichols lässt die 14-jährige Isabel davon erzählen und fokussiert so auf deren enges Umfeld. In einer
Zeit, in der persönlich überbrachte Nachrichten das einzige Medium darstellten, sind größere
Dimensionen jener Seuche nur erahnbar. Umso intensiver ist die Teilhabe an Isabels persönlichen Erfahrungen. Das Mädchen lebt mit ihren vielen Geschwistern, ihrer Stiefmutter und ihrem Vater auf einem keinen Hof, als die Pest ihr Dorf erreicht. Die Schilderungen der zunehmenden Todesfälle, vor allem aber die Lösungsversuche der BewohnerInnen sind eindringlich: In Zeiten höchster Frömmigkeit, in der sich Glaube von Aberglaube kaum unterschied und christliche und/oder heidnische Riten wie Reliquienverehrung oder Wahrsagerei den Alltag bestimmen, suchen die Menschen verschiedenste Wege des Heils. Entkommen kann der Pest aber niemand und so ist der Text geprägt von der dominanten Gegenwart des Todes. Dieser Trostlosigkeit setzt der Roman die familiären und freundschaftlichen Gefüge in Isabels Leben entgegen: In der gegenseitigen Sorge umeinander wird die Dringlichkeit zur Caritas deutlich, aber auch deren Grenzen: Denn wie gestaltet sich Nächstenliebe, wenn dein Nächster stirbt?
Leitmotiv des Textes ist jedweder Wegfall von struktureller Ordnung, die im Mittelalter vor allem kirchliche Ordnung war. Und mit jedem Priester der stirbt, mit jeder Autorität, die verschwindet, liegt es mehr und mehr an den Laien, Trost zu spenden und ein Sterben in Würde zu ermöglichen, selbst wenn ganze Leichenberge vor den Toren liegen, wenn der „gute Tod“ nicht mehr möglich ist: „Bei einem guten Tod kommt ein Priester in der Soutane ins Haus, hinter ihm die Dorfgemeinschaft mit Kerzen, Glöckchen und Gebeten. Bei einem guten Tod gibt es Weihwasser in den Zimmerecken, die Beichte, die Absolution und die Letzte Ölung, die Hostie und den Messwein, um die Dämonen zu vertreiben, die um den Kopf des Sterbenden schweben und ihn in die Hölle ziehen wollen.“ Wenn sich etwa Isabels Eltern gegenseitig die Beichte abnehmen, weil kein Geistlicher mehr da ist, wird Laienapostolat aus dringender Not heraus spürbar.
Kirche ist so nur mehr im persönlichen Glauben an Gott sichtbar, doch dieser wird angesichts der
Katastrophe hinterfragt: „Manche sagen, die Pest sei eine von Gott gesandte Seuche, mit der er die Bösen vernichten will oder vielleicht die ganze Welt, daher hilft nichts dagegen. […] Findet er etwa Leute wie die Mönche oder Robins Mutter oder die kleine Joanie Fischer böse? Ich weigere mich, das zu glauben, auch wenn Er mich dafür in die Hölle schickt. Was glaubt Er denn, was Er da tut?“ Sally Nicholls erzählt so von Theodizee im Kontext von Gottesfürchtigkeit und verschiebt die Akzentuierung der Frage: Nicht, warum Gott passiv bleibt und das Sterben zulässt, sondern warum er so viele Menschen bestrafen möchte. In dieser von Isabel immer wieder artikulierten Frage greift die Autorin auch auf die biblische Erzählung von Noah zurück und lässt den Roman in dessen Tradition enden: Denn trotz allen Leids, das Isabel und ihre dezimierte Familie erfahren muss, wird der Neubeginn am Ende dieser Jahre deutlich. Manche Historiker attestieren, die Erfahrung der Pest und der Bevölkerungseinbruch hätten das Ende des mittelalterlichen Welt- und Menschenbildes eingeläutet und soziale Umbrüche bewirkt. Dementsprechend steht Isabel am Ende vor einer neuen Welt: „Bald wird es Frühling. Eine neue Ernte. Ein neues Jahr.“
Im Nachwort schreibt Sally Nicholls selbst, sie wollte mit ihrem Roman zeigen, „dass Menschen eine erstaunliche Fähigkeit besitzen, in den Ruinen ihrer Welt zu stehen und sie aus der Asche wieder neu aufzubauen.“ Die Idee der apokalyptischen Tabula rasa und des daraus resultierenden Neubeginns stellt „Keiner kommt davon“ in die unmittelbare Nachbarschaft gegenwärtig populärer dystopischer und postapokalyptischer Texte, verortet die Krise aber nicht in der Zukunft, sondern in unserer realen Vergangenheit.
Christina Ulm
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2014
