 Religiöses Buch im Oktober 2013
Religiöses Buch im Oktober 2013
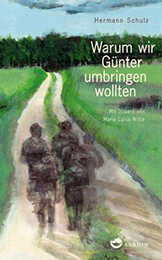
Hermann Schulz: Warum wir Günter umbringen wollten. Ill. v. Maria Luisa Witte Hamburg: Aladin 2013.
Es ist März 1947, Nachkriegszeit in Deutschland. Eine Zeit des Trauerns um die Toten des Krieges und des Wartens auf vermisste Verwandte und Freunde. Der Krieg hat unüberbrückbare Lücken gerissen, tausende Flüchtlinge aus dem Osten entwurzelt, die Menschen blieben verroht zurück. Ideale müssen neu gefunden werden, es fehlt an moralischen Instanzen, an Vorbildern, an Halt. In dieser Atmosphäre spielt der neue Roman von Hermann Schulz, in dem er eine wahre Begebenheit aus seiner Kindheit literarisiert. Der kindliche Ich-Erzähler Freddy wurde bei Verwandten auf dem Land untergebracht, wo zumindest die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert ist. Es geht ihm gut dort. Mit seinen Freunden zieht er durch Wald und Wiesen. Nur einer stört: Der Flüchtlingsjunge Günter. Er ist ein wenig anders, langsamer, stottert und hat einfach immer eine Rotznase. Er nervt die Gruppe sogar, „wenn er stumm hinter uns herlatschte.“ An einem Sonntagnachmittag reicht es ihnen: sie pinkeln ihm in die Hosentaschen, stecken ihn in eine Lore bei der Torfgrube und bewerfen diese mit Steinen. Günter überlebt und geht einfach weg. Nach und nach bekommen die sechs Burschen Panik: Wenn er sie verpfeift, könnte das für alle von ihnen schlimme Konsequenzen haben. Abgesehen von Prügel und Strafen fürchten so manche von ihnen, in eine Erziehungsanstalt verfrachtet zu werden. Also bleibt nur eins: Günter muss weg. Sie schmieden einen mörderischen Plan und sind dabei zerrissen. So ganz wohl ist keinem dabei, aber andere Lösungsmöglichkeiten fallen ihnen nicht ein. Eindringlich gelingt Hermann Schulz die Schilderung der inneren Konflikte zwischen Schuld und Verantwortung, die der Ich-Erzähler durchlebt. Hier ist ganz deutlich spürbar, was der Krieg und die menschenverachtenden Ideologie der Nazis auch mit den Kindern gemacht hat und wie sehr sie auf der Suche nach moralischem Halt ins Leere fassen müssen. „Und die Erwachsenen? Was machen die mit uns, wenn es rauskommt?“
„Es kommt nicht raus, wenn wir dichthalten. Und außerdem machen die gar nichts!“, ereiferte sich Leonhard. „Was meinst du, wie viele die im Krieg umgebracht haben? Vor allem solche. Und Juden und Russen und so was.“
„Solche? Wen meinst du damit?“, fragte ich.
„Solche, die einen Knall haben, die Blöden. Frag mal die Erwachsenen!“
Dass es dann im Endeffekt doch ein Erwachsener – noch dazu ein ehemaliger SS-Mann – ist, der das Schlimmste verhindern kann, zeigt deutlich, wie schwierig in dieser Epoche ohne Werte und Regeln eine klare Unterscheidung zwischen „Gut“ und „Böse“ ist.
Hermann Schulz gelingt ein spannender, dicht erzählter und betroffen machender Roman. Nicht nur, weil er die Jahre nach dem Krieg so eindringlich spürbar macht, sondern auch, weil er für Jugendliche heute zahlreiche Anknüpfungspunkte liefert. Die Themen Gewalt und Mobbing gegen Außenseiter sind zeitlos, genauso wie die Situation, in der sich der Ich-Erzähler befindet – zwischen Gruppenzwang und Gewissen.
Martina Reiter
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2013
