 Religiöses Buch im Mai 2013
Religiöses Buch im Mai 2013
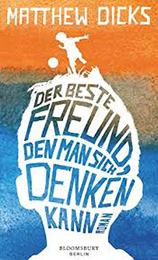
Matthew Dicks: Der beste Freund, den man sich denken kann. Aus dem Engl. v. Cornelia C. Walter Berlin: Piper 2013.
„Was ich weiß“.
Mit diesen Worten und einer anschließenden Beschreibung seiner selbst beginnt der IchErzähler Budo seine Geschichte. Damit verweist er schon ganz konkret auf jenes existentielle Moment, das diesem Roman eingeschrieben ist: Das was den Menschen in seinem Wesen ausmacht, ist auch das Bewusstsein um die eigene Existenz.
Für Budo ist das ständige Hinterfragen seines Daseins jedoch von ganz besonderer
Dringlichkeit: Denn Budo ist das, was man einen „imaginären Freund“ nennt, obwohl sich Budo selbst gar nicht „imaginär“ fühlt. Seit sechs Jahren ist der der beste Freund von Max, einem Jungen mit Aspergersyndrom. Sein ausgedachter Begleiter hilft ihm bei der Bewältigung zahlreicher sozialer Herausforderungen: die Erwartungen und Überforderung von Max Eltern, das Unverständnis mancher Mitschüler*innen, das sogar zu Mobbing führt und das bisweilen unangebrachte Verhalten der Lehrer*innen. Max Richtlinien gehen dabei nicht immer mit denen seines Umfelds konform. Budo zeigt sich in seiner Rolle als Beobachter sehr warmherzig und in seinen Beschreibungen wird Max, sein Umfeld, aber auch Budo selbst, der immer in Angst lebt, eines Tages „vergessen“ zu werden, sehr vielschichtig charakterisiert.
Laut Budo ist Max ein Kind, das auf der „Innenseite“ lebt. „Max hat keine Außenseite. Max besteht komplett aus Innenseite.“ Dementsprechend groß ist auch sein Vorstellungsvermögen, und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf seinen Freund Budo: Entgegen zahlreicher anderer imaginärer Freund*innen im Umfeld der beiden ist Budo nämlich vollständig ausgedacht: Er sieht sehr menschlich aus und hat auch seinen eigenen Willen. So formuliert er zwar: „Solange Max an mich glaubt, existiere ich“, aber auch: „Ich habe auch meine eigenen Vorstellungen und mein eigenes Leben außerhalb von ihm.“ Diese Gedanken verweist in einer ganz besonderen Weise auf die göttliche Idee hinter allen Dingen, auf die wechselseitige Verbindung zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Eingewoben sind sie hier in einen spannenden Plot, der die Beziehung zwischen Budo und Max ganz konkret sichtbar macht und beide Jungen auf ihre Weise herausfordert:
Denn Max wird eines Tages von einer Lehrerin entführt und festgehalten, die den Verlust ihres eigenen Kindes kompensieren, und ihm eine neue Mutter sein will. Während die Angehörigen von Max keinen Anhaltspunkt haben, wo er sein könnte, weiß Budo zwar um seinen Aufenthaltsort, kann sich aber natürlich niemandem mitteilen. So beschließt er andere imaginäre Freund*innen um Hilfe zu bitten. Viele dementsprechende Begegnungen kreuzen seinen Weg und lassen viele unterschiedliche (kindliche) Konzepte von Freundschaft erkennen. Als Budo auf den hünenhaften Oswald trifft, der als einziger imaginärer Freund auch Dinge in der realen Welt berühren und bewegen kann, verlagert sich der Roman ins Phantastische, kehrt zur finalen Rettung von Max allerdings in Psychologische zurück: Denn das was Max letztendlich aus seiner Gefangenschaft befreit ist er selbst. Indem Budo über sich selbst hinauswächst, hilft er Max seine inneren Barrieren zu überwinden. Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist eine der vielen schönen Ideen der Erzählung, die gleichermaßen lockere Unterhaltung wie tiefsinnige Ideen bietet.
Der Frage nach Budos Existenz folgend endet der Roman sehr konsequent: Mit dem großen Entwicklungsschritt von Max ist Budo als unsichtbare Hilfe obsolet geworden. Seine Existenz damit beendet. Und doch setzt der Epilog einen neuen Anfang an den Schluss; und ein ganz neues Bewusstsein von Budo – um das, was „danach“ kommt …
Christina Ulm
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2013
