 Religiöses Buch im Juli 2012
Religiöses Buch im Juli 2012
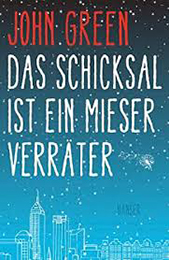
John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Aus dem Engl. v. Sophia Zeitz München/Wien: Hanser 2012.
Der Frage nach der Rechtfertigung Gottes im Angesicht des menschlichen Leidens wird in
Kunst und Literatur auf vielfache Weise gestellt – die Jugendliteratur jedoch zeigt sich der Theodizee gegenüber thematisch zurückhaltend. Selten reflektiert das Leiden an sich selbst und an der Welt, das die Adoleszenzphase und damit auch die moderne Adoleszenzliteratur bestimmt, auf die Frage nach einem Gott, wie das zum Beispiel Ödön von Horvath in „Jugend ohne Gott“ sehr wohl getan hat. Ein spezifischer, abseits solcher Kriegserfahrungen verorteter Leidensprozess hingegen wird in der modernen Jugendliteratur gerne unter dem Label ungebrochener Zuversicht präsentiert. Doch: Das Leben ist keine Wunscherfüllmaschine. Der Anspruch, das Leben zu lieben, greift für Figuren wie Hazel, Gus oder Isaac zu hoch; vielmehr geht es darum, das Leben zu leben – und dabei die eigene Würde zu wahren. Mit der Liebe hingegen hat man gelernt, vorsichtig umzugehen; und wohl gerade deswegen entstehen unvergleichliche Liebesbeziehungen zwischen den Jugendlichen.
Hazel Grace Lancester ist 16 und dem Tod durch Schilddrüsenkrebs nur knapp entkommen.
Das fiktive Medikament Phalanxifor ermöglicht es dem amerikanischen Erfolgsautor John Green, Hazels Leben zu stunden, und sie als Außenseiterfigur auf den fragilen Untergrund vorläufiger gesundheitlicher Stabilität zu stellen. Ihre Sauerstoffflasche ständig im Schlepptau verlässt Hazel nur selten das sichere Umfeld der eigenen vier Wände und zieht sich zuallererst in eine Welt der Bücher zurück. Wozu sie sich von ihrer Mutter noch drängen lässt ist eine Selbsthilfegruppe krebskranker Jugendlicher, die John Green als Parodie ihrer selbst beschreibt und damit einen humorvollen Ausgangspunkt nicht minder skurriler Begegnungen wählt: Isaac, der kurz vor einer Augenoperation steht, die ihn zwar vom Krebs befreien, dafür aber erblinden lassen wird, wird erstmals von einem Freund begleitet – Augustus Waters, genannt Gus, dem es mit seinem schiefen Lächeln gelingt, Hazel aus der Reserve zu locken. Gus ist 17 und hat eines seiner Beine an ein Osteosarkom verloren, gilt derzeit aber als krebsfrei. Zwischen ihm und Hazel entwickelt sich eine spröde Freundschaft, immer an der Kippe zur Liebesgeschichte, der Hazel sich jedoch verweigert: Sie will nicht riskieren, dass Gus‘ eigener Schmerz noch durch den Verlustschmerz gesteigert wird, sollte das Phalanxofor seine Wunderwirkung verlieren oder Hazels Problem mit dem sich ansammelnden Wasser in der Lunge eines Tages irreparabel sein.
Das Gefühl des von Gott verlassen Seins, das Jesus schmerzerfüllt am Kreuz formuliert, wird hier auf die unterschiedlichen Beziehungsmuster in Freundeskreis und Familie transferiert. Der eigene Schmerz spiegelt sich stets in der Sorge der nahestehenden Menschen und potenziert sich im Gefühl, anderen allein durch die eigene Existenz Schmerz zufügen zu müssen – und damit umso verlassener zu sein. Es ist schrecklich, mit 16 zu sterben, formuliert Hazel einmal mit Blick auf ihre Mutter; aber wie schrecklich muss es erst sein, eine Tochter zu haben, die mit 16 stirbt?
Zum dramaturgischen Wendepunkt wird eine gemeinsame Reise von Hazel und Gus nach
Amsterdam, mit der Gus Hazel ihren größten Wunsch erfüllen will: den Autor ihres Lieblingsromans zu treffen und ihm Fragen zu seinem Werk zu stellen, das endet wie auch das Leben: Von einem Moment auf den anderen. Das mit Überschwang Erhoffte tritt nicht ein; dafür jedoch erfüllt sich eine stille Sehnsucht der beiden. Doch auf andere Weise als erwartet wird ihrer Liebesgeschichte (erneut) ein Ablaufdatum aufgedrückt – und hier beginnt
John Green den trockenen Humor seines Erzählens (bestimmt durch die Dialoge zwischen
Hazel, Gus und Isaac), sowie seine Direktheit im Umgang mit seinen Figuren und deren
(körperlichen wie emotionalen) Deformationen mit entwaffnender Ehrlichkeit zu
kombinieren. Zu sterben ist kein heroischer Akt; es hat mit körperlichem Verfall und dem Verlust der eigenen Würde zu tun – aber auch mit der Loyalität jener, die lieben und glauben. Der Schmerz verlangt, gespürt zu werden, formuliert Gus einmal. Dies gilt auch und insbesondere für den Lektüreprozess dieses Buches, das so sehr gegen den Strich von sommerlicher Lektüre gearbeitet und erzählerisch dennoch so scheinbar leichtfüßig gestaltet ist, dass sich die bitteren Tränen dann doch am Salzwasser südlicher Meere am besten weinen.
Heidi Lexe
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2012
