 Religiöses Buch im März 2012
Religiöses Buch im März 2012
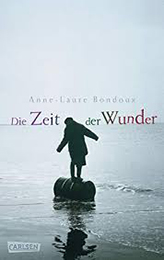
Anne-Laure Bondoux: Die Zeit der Wunder. Hamburg: Carlsen 2012.
Der 28. Dezember gilt als „Tag der unschuldigen Kinder“. Im Jahr 505 erstmals in einem nordafrikanischen Kalender erwähnt, erinnert er an den Kindermord in Betlehem, als auf Geheiß von König Herodes alle neugeborenen Kinder umgebracht werden – in der Hoffnung, der verheißene König der Juden sei unter ihnen. Die französische Autorin stellt ihren kindlichen Protagonisten mitten hinein in diesen Kontext der unschuldigen Kinder, die verstrickt sind in die historische Schuld ihres Landes: Am 28. Dezember des Jahres 1985 wird ihr Ich-Erzähler auf einer Obstplantage in Abchasien geboren. Doch erst am Ende des Romans wird die „wahre“ Biografie des Jungen – und mit ihr dieses Geburtsdatum – offengelegt. Eröffnet wird der Roman hingegen mit den Worten: „Ich heiße Blaise Fortune und ich bin Bürger der Französischen Republik. Das ist die reine Wahrheit.“ Die Macht des Schicksals ist es also, die den Lebensweg von Blaise Fortune prägt: Immer und immer wieder lässt er sich von Gloria jene Geschichte erzählen, die von einem Zugunglück im Kaukasus handelt, von einer schwer verletzten französischen Frau, die Gloria ihr
Baby anvertraut. Unbeirrbar wird die Fabel dieser Vergangenheit als Investition in die
Zukunft ausgedeutet: Blaise Fortune soll zurück nach Frankreich, in das Land der Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit – weg aus dem Kaukasus, jener nach dem Zerfall der
Sowjetunion instabilen und in sich zerfallenden Region, die unter den Folgen von Befreiungs- und Bürgerkrieg(en) leidet. Hinter der wundersamen Geschichte seiner Rettung aus dem verunglückten Zug jedoch verbirgt sich das Geheimnis um die Herkunft von Blaise Fortune. Dem entsprechend erzählt Anne-Laure Bondoux parallel zum Fluchtweg durch den Kaukasus und in der Folge vom Kaukasus nach Frankreich die Geschichte einer Identitätssuche.
Blaise Fortunesälteste Erinnerung (sie wird auch an den Beginn des Romans gestellt) reicht zurück ins Jahr 1992, als Gloria und er gemeinsam mit anderen Flüchtlingsfamilien im Großen Haus leben, schon bald aber von den Wirren der Ereignisse in Georgien und dessen
Teilrepublik Abchasien weitergetrieben werden, um letztlich – so Glorias Plan – von der Hafenstadt Suchumi aus nach Frankreich zu gelangen. An jede ihrer Stationen wird ein wie leichthin geknüpftes Geflecht an Figurengebunden, die Blaise Fortunes kindlichen Erkenntnisprozess in den Kontext von Geschichten und Schicksale vor ganz
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund stellen. Trotz dem Schrecken, den viele dieser Lebensgeschichten bergen, und trotz dem stets aufs Neue relevanten Trennungsschmerz, gerät Blaise Fortuneshoffnungsvoller Blick auf die Welt niemals ins Wanken – zu tief hat Gloria diese Überzeugung in seine Seele versenkt.
Daher wird auch der Erzählton der Geschichte von diesem hoffnungsvollen Blick geprägt, wenn Blaise Fortune seine Erinnerungen und Erlebnisse schildert. Er wächst auf unter dem Namen Koumaïl; Fatima, deren Vater im Osten des Kaukasus von Milizeinheiten getötet wurde, erklärt ihm dessen Bedeutung: allumfassend. Und genau darin liegt der Zauber der von Anne-Laure Bondeaux in den Mittelpunkt ihres Erzählens gesetzten Figur: Koumaïl selbst ist gleichermaßen das Geheimnis und das Wunder dieser Geschichte, die in reduzierten poetischen Bildern Leiden schildert und doch nie als letztgültig stehen lässt.
Obwohl retrospektiv erzählt wird, macht der Roman das Erleben seines Ich-Erzählers in dessen emotionaler Dimension präsent und transferiert dabei Gottes unergründliche Wege in politisch brisantes Geschehen. Lyrisch und humorvoll verwendet (und seelenvoll ins Deutsche übertragen) dient Sprache dabei als identitätsstiftendes Moment; insbesondere dann, wenn Koumaïl von Gloria auf eine hoffnungsvolle Zukunft in Frankreich eingeschworen wird. Ihre kleinen Rituale geben ihm auch dann noch Zuversicht, als er (bereits von Gloria getrennt) den mühseligen Prozess der Immigration durchlaufen muss. Entspricht– so muss dabei gefragt werden – Frankreichs Asylrecht noch den Idealen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit? (Trotz Abweichungen zum deutschen oder österreichischen Asylrecht dürfen/müssen diese Fragen als Grundsatzfragen zum Asyl- und Menschenrechtsverständnis der EU und vieler ihrer mit Nationalismus und Rechtspopulistisch kämpfenden Mitgliedsstaaten gesehen werden.) Dennoch geht es Anne-Laure Bondouxnie um die ideologische Wertung der Ereignisse; vielmehr stellt sie die Frage nach moralischen Überzeugungen aus unterschiedlichen Perspektiven – und damit immer wieder neu. Dem entspricht auch die Tatsache, dass am Ende Koumaïls Geschichtenoch einmal und unter ganz anderen Voraussetzungen erzählt werden muss.
Gerade in seinen Auslassungen liegt die erzählerische Stärke des Romans, der Hoffnung profiliert der Menschenverachtung und Verzweiflung entgegen setzt und damit durchaus den Charakter eines Hymnus erhält. So wie die literarische Balance zwischen dem real erlebten
Leid und dem Traum von einer besseren Zukunft gehalten wird, verklingt auch dort, wo Unheil und Schuld Koumaïls Geschichte prägen, nie der Hochgesang von der Herrlichkeit eines Lebens, das auf Liebe gründet.
Gloria ist es, die diesen Hochgesang nicht nur angestimmt, sondern verkörpert hat. Am Ende des Romans findet Koumaïl, der nun Bürger der Französischen Republik ist und Blaise Fortune heißt, sie in einem Krankenhaus in Tiflis wieder. Und erst mit dieser Rückkehr ist ihm der eigentliche Neubeginn möglich. „Gibt es einen Unterschied zwischen dem Erzählen einer Lüge und dem Erfinden einer Geschichte“, fragt Koumaïl (der jetzt ganz offiziell Blaise Fortune heißt) sich? Zu einem Zeitpunkt, da die Lüge sein Leben gerettet und er doch zu seiner eigenen Geschichte gefunden hat. Denn die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit (der Wunder).
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2012
