 Religiöses Buch im Dezember 2011
Religiöses Buch im Dezember 2011
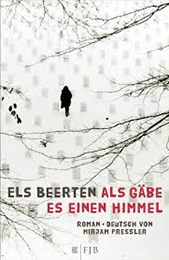
Els Beerten: Als gäbe es einen Himmel: Aus dem Niederländischen von Mirjam Pressler. Frankfurt/M: FJB 2011.
„Ich weiß nur eines: Wenn die Menschen nicht mitarbeiten, wird nie ein Wunder Erfolg haben.“
Kann es Wunder geben in einer Zeit wie jener des Zweiten Weltkrieges? Diese Frage hat bereits der 2011 mit dem Katholischen Kinderbuchpreis ausgezeichnete Kinderroman „Einmal“ von Morris Gleitzman gestellt – die Geschichte eines Kindes, das mit seiner Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, das Erleben im Holocaust für sich und seine Umgebung auf hoffnungsfrohe Weise ausdeutet.
Els Beerten geht in ihrem mehrperspektivisch erzählten und komplex angelegten
Jugendroman ganz anders vor; und doch bewahrt sie ein Stück dieser naiv-kindlichen
Wunderkraft. Sie transferiert sie in den Bereich der Musik und ordnet sie der jüngsten ihrer Erzähler*innenfiguren zu: Remi Claessen, hochbegabt an der Trompete, versucht mit seinem Spiel seinen älteren Bruder Jef Claessen an entscheidenden Stellen dem Schicksal durch ein Wunder zu entreißen.
Gemeint ist damit wohl zuallererst ein emotionales Wunder, das den Figuren hilft, die bittere Zeit zu überstehen. Els Beerten siedelt ihren Roman im Abseits des Zweiten Weltkrieges an; es geht weniger um die Kriegshandlungen an sich und es geht nicht um den Holocaust (auch wenn erste mündliche Berichte über Vernichtungslager entsprechenden Einfluss auf die Figuren nehmen). Es geht vielmehr um die Frage, wie der Krieg den Mikrokosmos von Familie und Dorfgemeinschaft beeinflusst – an einem Ort, an dem der Krieg nicht im Sinne von unmittelbaren Kriegshandlungen oder Bombardierungen stattfindet: In einem kleinen Dorf in der Nähe des belgischen Ortes Hasselt leben Jef und Remi Claessen gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester Renée, neben den beiden Brüdern eine weitere IchErzählerin. Ebenso wie Ward Dusoleil, ein Jugendlicher in Jefs Alter, den die drei Geschwister in der örtlichen Blaskapelle kennen lernen und der den dreien rasch auf unterschiedliche Weise freundschaftlich und liebevoll verbunden ist.
Die erzählerische Klammer des Romans bildet ein Begräbnis im Jahr 1967; dazwischen werden Ereignisse aus den Jahren 1943 und 1945 positioniert – wobei jeweils aus der Zeit heraus und doch stets auch rückblickend auf jeweils davorliegende Ereignisse erzählt wird. Es wird verwiesen, zurückgegriffen, angedeutet. Das daraus resultierende zeitliche Patchwork wird erst nach und nach geordnet, die vorerst sprunghafte Kamera fährt erst nach und nach zurück, um am Ende des Romans das Gesamtbild in den Blick zu nehmen.
Zum Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse wird dabei eine Nacht im Mai 1944; in dieser
Nacht werden in einer abgelegenen Hütte außerhalb des Dorfes vier Mitglieder der belgischen Widerstandsbewegung von Mitgliedern des Vlaams National Verbond (VNV) überfallen. Es gibt Tote auf beiden Seiten zu beklagen; es gibt einen der Tat beschuldigten (Ward Dusoleil); und es gibt eine Medaille, die für die tapfere Rettung der überlebenden Widerstandskämpfer an Jef Claessen vergeben wird. Eben diese Medaille wird zum äußeren Symbol für ein belastendes Geheimnis, das die dramaturgische Struktur des Romans prägt: Was in jener Nacht wirklich passiert ist, wird erst an dessen Schluss offengelegt.
Zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns bereits im Jahr 1946 und der Krieg ist zu Ende. Ein Krieg, aus dem die Familie Claessen sich – der Vorgabe des Vaters entsprechend – immer sehr nachhaltig herausgehalten hat. Und damit in eine Art (ideologischer) Opposition zu Ward Dusoleil tritt. Er ist dem Wunsch, Heldenmut zu beweisen, erlegen und muss dafür bitter bezahlen.
In diesem Zusammenhang scheut Els Beerten scheut nicht vor der Schilderung der äußerst fragwürdigen Rolle der Kirche im Zweiten Weltkrieg zurück. Es ist ein gewisser Pfarrer Vanden Avenne der eines Tages im Jahr 1943 in der Klasse von Ward Dusoleil und Jeff Claessen auftaucht und die Schüler vor der roten Gefahr aus dem Osten warnt: „Die Russen möchten uns Gott wegnehmen“ ist sein hetzerische Argument. „Sie ermorden Säuglinge, Kinder, Frauen und dann rauben sie die Häuser als und brennen alles nieder, was sie antreffen. Sie sind keine Menschen. Kein Wunder, dass sie Gott nicht kennen.“ Im Kampf gegen die Russen bleibt es einerlei, mit wem man sich verbündet, denn „es wäre ein Verbrechen, wenn die Russen den Krieg gewinnen würden. Es wäre die Hölle, die Hölle auf
Erden. […] Und wir wollen doch alle in den Himmel, nicht wahr.“
Mit der Hilfe von Vanden Avenne werden die Jugendlichen von der VNV angeworben und in der Armee Hitler-Deutschlands einer eigenen belgischen Einheit an die Ostfront geschickt. Sie werden also nicht nur als Kanonenfutter ins Kriegsgeschehen geworfen, sondern stellen sich damit auch – im Glauben für das eigene Volk zu kämpfen – gegen den aktiven oder passiven Widerstand des belgischen Volkes gegen die nationalsozialistischen Okkupatoren. Sowohl Ward Dusoleil als auch Jef Claessen lassen sich vom national verbrämten Wunsch, das scheinbar Richtige zu tun, anstecken. Doch nur Ward tritt letztlich in die nationalsozialistische Armee ein und dient sich rasch zum SS-Sturmführer hoch.
Aus dem Spannungsmoment der Frage nach dem adäquaten Handeln heraus, positioniert Els
Beerten ihre vier Ich-Erzähler*innen. Die Perspektivierung des Romans entspricht dabei seiner
Zeitstruktur. Was zu Beginn durchaus verwirrend wirkt, macht den literarischen Anspruch des
Romans aus: Erzählt wird abwechselnd aus der Perspektive der vier Hauptfiguren Jef, Renée, Remi und Ward – wobei die Identität von Ward Dusoleil erst nach und nach offengelegt wird. Dieses geschickt platzierte Moment der Unklarheit gibt dabei klug das Dilemma wieder, in dem die Jugendlichen stehen: Wie sind die Ereignisse aus der Zeit heraus einzuschätzen? Wie lassen sich diese Ereignisse zu einem politischen Gesamtbild fügen? Wie gilt es, sich in dieser Zeit zu positionieren? Diese grundsätzlichen Fragestellungen bleiben für alle vier Figuren gleich – auch wenn die Perspektivierungen changieren. Entsprechend bleibt auch in den einzelnen Kapiteln stets einige Zeit unklar, wem die jeweilige Erzählstimme gehört. Auch im Detail verästelt sich der vorerst gemeinsame Weg der vier Figuren also immer erst mit seinem konkreten Verlauf. Erzählt wird dabei von allen vier Figuren sprachlich klar und unverschnörkelt der eigenen Wahrnehmung folgend, emotional gefärbt und doch ohne jeden Pathos.
Diese Erzählkonstruktion des Romans fordert heraus und bedarf sicher einer gewissen literarischen Kompetenz. Mit seinen Fragen nach Schuld und Schuldverstrickung jedoch richtet sich der Roman zuallererst an Jugendliche, die nicht nur bereits über zeitgeschichtliches Hintergrundwissen verfügen, sondern auch konfrontieren wollen. Gleichzeitig aber eine Lektüre zur Verfügung gestellt bekommen, die auf Grund ihrer dramaturgischen Komposition und sprachlichen Geradlinigkeit das Mehr-Wissen-Wollen und Mehr-Lesen-Wollen über die 600 Seiten des Romans gekonnt vorantreibt.
Heidi Lexe
>>> hier geht es zu den Religiösen Bücher 2011
