Thema: Peter Pan

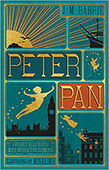
James M. Barrie: Peter Pan
Die literarische Existenz Peter Pans beginnt bereits sieben Jahre vor der Ersterscheinung jenes Romans, der heute nach ihm benannt ist. In der an Erwachsene adressierten Geschichtensammlung „The Little White Bird“ taucht die liminale Kind-Figur erstmals auf: Im Alter von sechs Jahren verlässt Peter Pan sein Kinderzimmer und lebt von da an unter den Vögeln in Kensington Gardens – auf einer Insel im kleinen See mit dem Namen The Serpentine. 1906 erscheint diese Geschichte als eigenständiges Buch, illustriert von Arthur Rackham, unter dem Titel „Peter Pan in Kensington Gardens“. Zwischen diesen beiden Erscheinungsdaten liegt die Geburtsstunde des Jungen, der nicht erwachsen werden wollte: Im Dezember 1904 hat das neue Theaterstück des Dramatikers James Barrie in London Premiere. Unter dem Titel "The Boy Who Wouldn’t Grow Up“ wird es zum großen Erfolg und zieht nach einigen Jahren erfolgreicher Bühnenpräsenz auch einen Medienwechsel nach sich: 1911 erscheint der Roman unter dem Titel „Peter und Wendy“. Markiert sind damit die beiden Welten, die bereits zu Beginn aufeinandertreffen: Hier die geordnete, liebevoll miteinander umgehende Londoner Familie mit den drei Kindern; dort das ewige Kind Peter Pan, der auf der Insel Neverland lebt, auf die man mit Hilfe von Feenstaub und klaren topografischen Angaben gelangt: Die zweite rechts, und dann geradeaus bis morgen. Dort, im Nichts und Nirgendwo, liegt jenes Land, das aus der Vorstellungskraft Peter Pans entspringt. Ein selbstreferenzieller Raum, dessen Gesetzmäßigkeiten allein Peter Pans Lust am Abenteuer folgen und dem entsprechend von Indianern und Piraten bevölkert wird. Seinem schon verlebten Gegenspieler Käptn Hook gegenüber gibt Peter Pan sich letztlich als allegorische Figur zu erkennen:
„Pan, wer oder was bist du?“
"Ich bin die Jugend, ich bin die Freude“ („I’m youth, I’m joy“)
Markiert ist damit eine Sehnsucht, die für Peter Pan mit einem dauerhaften Hier und Jetzt verbunden ist. Peter Pans Biografie bleibt auf fragmentarische Kindheitserinnerungen begrenzt, er schafft Wendy, aber niemals sich selbst Erinnerungen. Auch wenn das Fenster im Kinderzimmer der Darlings stets für ihn offenbleibt, wird Peter Pans an den Urschrei des arkadischen Hirtengottes erinnerndes Krähen erschallen, solange Kinder froh, unschuldig und herzlos sind.
Aus dem Engl. v. Bernd Wilms.
Cecilie Dressler Verlag 2001 [EA1988].
220 S.
James M. Barrie / MinaLima Designs: Peter Pan
Fechten, singen, fliegen – es geht sehr dynamisch zu in der Geschichte von Peter Pan. So stellt sich bei jeder Buch-Fassung auch die Frage, wie die ursprünglich theatralen Elemente buchgestalterisch umgesetzt werden – oder eben nicht. 2017 erschien bei Coppenrath eine Peter Pan-Variante, für deren Gestaltung MinaLima verantwortlich zeichnet, jenes Grafikduo, das die grafisch-visuelle Gestaltung der "Harry-Potter"- und "Fantastic Beasts"-Filme übernommen hat. Ihre kunstvolle Art, im Buch nicht nur mit Illustrationen und Design, sondern auch aufklappbaren oder anders bespielbaren Papierelementen zu arbeiten, entspricht der angesprochenen Dynamik der Geschichte auf geniale Weise, ebenso wie den beiden Handlungsebenen des Romans, dem bürgerlichen Londoner Haus Nr. 14, in dem die Darling Kinder aufwachsen, und dem abenteuerlichen Nimmerland, in das sie mit Peter Pan reisen. Paradigmatisch umgesetzt wird dies schon im allerersten der Papierelemente: Außen stellt es ein Krankenblatt der Darling-Kinder dar, historisierend auf leicht vergilbtem, kariertem Papier, ganz detailgenau mit Stempeln und handschriftlicher Notiz des Arztes ausgestaltet, ein Sinnbild für den Alltag. Klappt man es aber auf, ist über den Köpfen der Kinder eine Landkarte von Nimmerland zu sehen. Das durchdachte Konzept beinhaltet jedem Kapitel zugeordnete Leitfarben, die sowohl als Hinter-grund als auch in Einzelillustrationen eingesetzt werden, und jedem Kapitel vorangestellte Schlüsselsätze der Handlung. So wird in dieser Prachtausgabe nicht nur gefochten, gesungen und geflogen, sondern auch aufgeklappt, gefaltet und gedreht – zum Beispiel an den Zeigern der Croc O´Clock Krokodilsuhr.
Aus dem Engl. v. Bernd Wilms.
Coppenrath 2017.
256 S.
James M. Barrie / Robert Ingpen: Peter Pan
Der vielfach ausgezeichnete, 1936 geborene australische Illustrator Robert Ingpen hat bereits zahlreiche Klassiker der Kinderliteratur bebildert. Von „Der geheime Garten“ über „Alice im Wunderland“ bis hin zu „Das Dschungelbuch“ zeichnet ihn sein charakteristischer Stil mit weicher, harmonischer Farb-gebung und präzisem, detailliertem Strich aus.
Für die bei Knesebeck auf Deutsch erschienene bibliophile Ausgabe hat Ingpen mehrere doppelseitige Illustrationen sowie zahlreiche kleinere Vignetten angefertigt, die in dem groß-formatigen Buch zwischen den ungekürzten, weiträumig gesetzten Textpassagen platziert werden. An manchen Stellen muten seine oftmals in Grau oder Sepiafarben gehaltenen Bilder wie Porträtstudien an, in welchen sich der Zeichner an unter-schiedlichen Perspektiven und Gesichtsausdrücken ausprobiert. An anderer Stelle wiederum setzt Ingpen großzügig Blau- und Gelbtöne ein, die erfrischend dynamische bzw. warm-wohlige Atmosphären erzeugen.
Lesenswert ist zudem auch das Vorwort, in dem der Urgroßneffe von James Matthew Barrie über die schicksalshafte Beziehung des 1937 verstorbenen britischen Autors mit seinen fünf Adoptivsöhnen und seiner Freundschaft mit dem Schriftsteller Robert Louis Stevenson berichtet.
Aus dem Engl. v. Martin Rometsch.
Knesebeck 2010.
216 S.
James M. Barrie / Susanne Janssen: Peter Pan
Die französische Version eines britischen Romans. Keine Sorge, es soll mit der Nennung dieser Ausgabe nicht um einen komparatistischen Gipfelsturm gehen. Zumal das Buch leider nicht mehr lieferbar ist. Dennoch soll die illustratorisch einzigartige Neu-Inszenierung des Klassikers der Kinderliteratur an dieser Stelle nicht ausgespart werden. Denn: Folgt man einer Definition des Klassikers (nach Heidi Lexe) entsteht dessen Status ja gerade aus jener intermedialen (Sinn-) Pflege, die im Kontext eines populären Kanons (nach Emer O’Sullivan) erfolgt. Und Susanne Janssen geht in ihrer illustratorischen Neu-Interpretation deutlich andere Wege als Illustrator*innen vor oder nach ihr. In ihrem expressiven Stil bürstet sie die viel beschworene Glorie ewiger Kindheit frappant gegen den Strich – und das, indem sie gerade die (begrenzten) Bewegungsmuster der Figuren nachzeichnet: Sie löst das exotische Inselkolorit auf und zeigt die dort stattfindenden Ereignisse als niemals endende Verfolgung. Piraten, Indianer und verlorene Jungs jagen einander, ohne einander jemals zu fangen. Das Rund dieser Insel inszeniert Susanne Janssen als eine aus der Perspektive geratene Scheibenwelt, in der sich Kapitän Hook und das Krokodil in ein Spiel fügen, in dem man einander belauert, einander aber niemals nahe kommt. Neverending ist diese story – und damit ist auch das Entwicklungspotential der Handelnden klar begrenzt.
Peter Pan wird in diesem Szenario zu einer Art erdigem Faun, dessen Dynamik die Szenerien bestimmt, der in seiner ewigen Kindlichkeit aber auch als Charakterkopf herangezoomt wird. So nahe, dass man förmlich zurück schreckt vor so viel Gleichmaß. Dabei aber den rechthaberischen Charakter des Mini-Absolu-tisten erkennt. Dieserart weiß die deutsche Künstlerin in ihrem Spiel mit intensiver Farbigkeit, verzerrten Größenordnungen und burlesken Figuren Hierarchien neu zu befragen. Wie in allen ihren Bilderbüchern zwingt sie die Betrachter*innen, hinzusehen; hinter die Kulissen einer naiven Abenteuergeschichte.
Editions Être 2004.
34 S.


Finding Neverland. Film von Marc Foster
Ein Hund auf der Bühne und Waisenkinder im Publikum. Innerhalb der wohlfeilen Londoner Gesellschaft scheint alles auf einen Skandal hinauszulaufen; und mündet doch ins allgemeine Glück darüber, dass Literatur, Film und Theater es schaffen, den kindlichen Blick auf die Welt zu konservieren.
Marc Foster greift in seinem Film auf Aspekte der Biografie von James Barrie zurück und arrangiert sie zu einer Freundschafts- und Liebesgeschichte gleichermaßen wie zu einer Entstehungs-geschichte des Theaterstücks „Peter Pan“: Der aus Schottland stammende Theaterautor (gespielt von Johnny Depp) lernt in den Londoner Kensington Gardens die Kinder der Familie Davies kennen und pflegt in Folge eine langjährige Beziehung zu ihnen. Im Film wird dieser historische Hintergrund auf eine intensive Zeit verkürzt, die einerseits von Barries nicht konvenierender Liebe zur alleinstehenden Mutter (Kate Winslet) der Kinder bestimmt wird, andererseits von seiner Freundschaft zu Peter Davies (unwiderstehlich: Freddie Highmore), in die zahlreiche Reflexionen über das Schreiben und Träumen, sowie den Traum vom Schreiben eingewoben sind.
Die glücklich verlebten Tage und die entgrenzten Spiel-Erfahrungen mit den Kindern inspirieren James Barrie zu einem neuen Theaterstück. Die Ereignisse rund um dessen Premiere nehmen den letzten Teil des Filmes ein und zeigen durchaus nicht ohne Pathos das Miteinander des ewigen Kindes auf der Bühne und des Autors dahinter, der sich selbst die eigene Kindlichkeit als Charaktereigenschaft zu bewahren sucht.
Ein Rührstück. Ein zauberhafter Film. Ein schauspielerisch wunderbar präsentierter Verweis auf die Biografie von James Barrie.
USA / UK 2004.
97 min.
Peter Pan. Disney-Film
Erster Stern rechts und dann immer der Nase nach ist die Navigation, die Peter Pan seinen Begleiter*innen über dem nächtlichen London gibt, damit sie auch sicher im Nimmerland ankommen. Fehlen darf dabei natürlich auch nicht die blonde kleine Naseweiß mit grünem Minikleid, die mit ihren Plüsch-pantoffeln und dem Feenstaub erst dafür sorgt, dass Wendy und ihre Brüder durch die Luft fliegen können. Wie für Disney üblich wird der Stoff des Ursprungstexts mit Liedern mit mehr oder minder eingängigen Texten untermalt wie Ich denke an Schokoladeies und den Sternnaseweis, ich denke an einen Indianerstamm, und ich an Tiger-Lily, das sanfte Lamm, womit die drei Geschwister (noch im eigenen Kinderzimmer) alles vorwegnehmen, was sie im fremden Land erwarten wird.
Im Nimmerland angekommen wird gleichsam der Textvorlage Naseweiß von Eifersucht gepackt, während Wendy ihrerseits eifersüchtig auf Tiger-Lily ist. Die beiden Brüder sind unterdessen vollauf damit beschäftigt, sich für Piraten oder Indianer zu halten und darüber das ferne Zuhause in London zu vergessen. Bis Wendy die beiden und die anderen verlorenen Jungs singend daran erinnert, was "eine Mutter" bedeutet, sodass sogar die lauschenden Piraten gerührt sind und nahezu in Tränen ausbrechen.
Film v. Clye Geronimi / Wilfred Jackson / Hamilton Luski. USA 1953.
78 min.

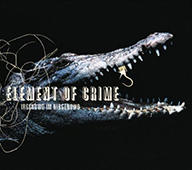
Andreas Steinhöfel: Der mechanische Prinz
Verlorene Kinder. In "Peter Pan" sammeln sie sich unter ihrem Anführer Peter Pan auf Neverland. Max ist ein solches verlorenes Kind – auch wenn er als Egal-Kind benannt wird:
Er war seiner Mutter vom ersten Tag seiner Geburt an egal gewesen. Wie er auch, seit er sich erinnern konnte, seinem Vater egal war. Tatsächlich war Max mit dem schrecklichen Gefühl aufgewachsen, eines der egalsten Kinder auf der Welt zu sein. (S. 13f.)
In einer Rahmenerzählung wendet sich dieser Max an den Schriftsteller Andreas S., um seine Geschichte zu erzählen –
die dann zur Binnenerzählung wird. In einer Alternativwelt der Berliner Großstadt dringt Max in die Untiefen der U-Bahn-Welt vor, die zu einer Seelenlandschaft wird, in der es gilt, sich selbst zu begegnen. Sich selbst zu erkennen.
Im Reich des Mechanischen Prinzen durchläuft Max unter-schiedliche Bewährungsräume, so genannte Refugien, deren Topografien stets auch die jeweilige emotionale Disposition von Max repräsentieren. Eines dieser Refugien heißt Nimmerland und ist nur eine von zahlreichen intertextuellen Anspielungen auf James Barries Roman. Denn das Motiv des Alter Ego, das die Binnenerzählung letztlich prägt, wird am Ende der Rahmen-handlung in Anspielung auf „Peter Pan“ noch einmal aufge-nommen: Max erkennt in dem mit einer Hündin Nana zusammen-lebenden Kinderbuchautor Andreas S. jenen aus dem Refugium Nimmerland entschwundenen Anführer der dort einst zahlreich lebenden Jungen. Der Kinderbuchautor ist Peter Pan; besser gesagt ist er im Sinne des Konstruktcharakters, den die Refugien mit Neverland gemeinsam haben, ein Alter Ego von James Barries literarischer Figur Peter Pan. Und fügt sich in ein Setting, in dem zahlreiche Figuren und Motive einer literarischen Tradition von Dantes „Göttlicher Komödie“ bis zur modernen Fantasy neu arrangiert werden.
Carlsen 2004.
272 S.
Element of Crime: Irgendwo im Nirgendwo.
Ich war dein allerbester Feind,
Du warst genauso schlimm wie ich.
Wir waren untrennbar vereint,
Doch scheißegal was kümmert's dich.
Du wirst ein Tierfilmgucker sein,
Mein Freund, wenn ich mal nicht mehr da bin.
Ein Tierfilmgucker. Ein Sitzenpinkler. Ein Schnittchenschmierer. Wird Peter Pan dieses traurige Schicksal wirklich ereilen, wenn er Käptn Hook als sein Pendant verloren haben wird? In ihrer reduzierten, melancholischen Art, die stark auf Gitarre, Bass und Vokals setzt, stellt die Band Element of Crime die Vermutung an, dass ein Leben wie jenes von Peter Pan nie aus sich selbst heraus funktionieren kann. Peter Pan braucht immer das kontrastive Gegenüber, braucht die figurale Folie, an die sein Leben als Alternative gelegt werden kann. Doch nicht Wendy ist es, die hier ein Liebeslied anstimmt, sondern eben der Piratenkapitän, der von Peter Pan im finalen Schwertkampf über die Planken gestoßen wird und im Bauch des Krokodils landet.
Element of Crime, Mitte der 1980er als jugendliche New Wave-Band gegründet (lang ist's her ...), schaffen es mit ihrem Chefkomponisten und Textautor Sven Regener bis heute, mit ihren selbstironischen Gänsehauttexte[n] die Welt kritisch auszuleuchten. Auch die Welt von Peter Pan, auf die sich die Band für eine Theaterinszenierung im Jahr 2000 eingelassen hat. Der gnadenlos infantile Ausflug des Regisseurs Leander Haußmann in das literarische Œuvre von James M. Barrie durfte bereits damals rasch wieder vergessen werden; die dafür komponierten Musik darf in einer Auswahl von 4 Songs hingegen weiterhin als intermedialer Kommentar zu Motivik und Figuren-konstellation des Romans gelten. In seiner interpretatorischen Haltung gleicht Sven Regener dabei Susanne Janssen – auch wenn deren Expressivität hier weit dunklerer Tonalität und rauen musikalischen Bildern weicht. Doch auch hier wird der reflektie-rende Blick auf eine Welt Irgendwo im Nirgendwo geworfen, die sich nur selbst genügt und in der damit alles ganz egal wird.
CD. Motor 2000.
14:38 min.


