 Kröte im April 2025
Kröte im April 2025
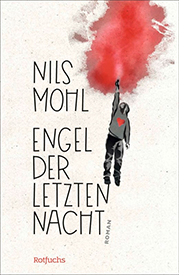
Rotfuchs 2025.
224 S.
Nils Mohl: Engel der letzten Nacht
„Wer bist du denn?“
„Das wüsste ich auch gerne. Vorschläge?“
Eine scheinbar adoleszente Frage – eingebaut in einen Dialog, in dem es ums Feiern und Abtanzen geht. Mitten in einer Abschlussfahrt zum Strand wird darüber diskutiert, wie man nicht nur Feiern, sondern Eskalieren könnte. Wie man die Nacht der Nächte verbringt. Und ob die ultimative Nacht nicht erst dann zu einer solchen wird, wenn es auch die letzte Nacht ist – wenn sie zu einem nicht mehr steigerbaren Erlebnis wird.
Vorschläge?
Nils Mohl greift an dieser Stelle seines neuen Romans jene sprachliche Klammer auf, die den zweiten Teil seiner Stadtrand-Trilogie gerahmt hat.
Woran glaubst Du?
Vorschläge?
heißt es dort im paratextuell platzierten Intro vor dem Einsetzen des ersten (metafiktionalen) Trailers – und am Ende kommt der Roman auf dieselbe, leicht modulierte Frage nochmal zurück. Einer Grammatik des Erwachsenwerdens, die Nils Mohl in der Trilogie entlang der christlichen Tugenden (Liebe – Glaube – Hoffnung) entwirft, moduliert er hier noch einmal neu: In der Stadtrandtrilogie hat sich die Notwendigkeit, eine fragmentierte Wirklichkeit in eine sinnstiftende Ordnung zu bringen, im a-chronologischen Erzählen gespiegelt. Hier ist von der Puzzlearbeit des Erwachsenwerdens die Rede:
„Man gibt uns vorgestanzte Teile, die wir dann zu einem für uns stimmigen Bild verbinden können. Beim Ausprobieren machen wir Fehler, bis wir selbst wissen, was richtig und was falsch ist.“ (53)
Leitfrage dieses Puzzlespiels:
„Wer bist Du denn?
„Das wüsste ich auch gerne. Vorschläge?“ (80)
Ausverhandelt wird diese Frage entlang der Ereignisse einer Nacht. Doch selbstverständlich wäre es kein Roman von Nils Mohl, würden diese Ereignisse einfach erzählt, ohne auf unterschiedlichen (formalen) Ebenen ineinander verschränkt zu werden. Die erzähltheoretische Raffinesse setzt mit dem kurzen Beginn-Kapitel ein, das der Protagonist gar nicht erst überlebt: Von der bereits erwähnten Abschlussfete rauscht er im Auto davon und lenkt den Wagen (absichtsvoll) in die Leitplanke (und darüber hinaus ...)
I’ll die happy tonight.
Dieses Zitat aus dem Song „Summertime Sadness“ ist dem Roman als ein Motto vorangestellt.
Doch Obacht: Bereits im Paratext setzt der Versuchs-Charakter des Textes ein. Dem gültigen Motto sind zwei bereits wieder durchgestrichene vorausgegangen.
Und genau diese Versuch-Anordnung setzt sich auch im Roman fort.
Und das ist es auch schon gewesen.
Das der Roman nicht dieserart auf Seite 14 enden kann, konnte vermutet werden. Was aber wird passieren? Man erinnere sich an Patrick Ness, der seinen Roman „Mehr als das“ ebenfalls mit dem Tod / dem Selbstmord einsetzten lässt. Dort erwacht der Protagonist in einer Matrix-ähnlichen Parallelwelt. Und auch Nils Mohl lässt die Frage nach dem eigenen Leben als Illusion nicht außen vor und führt im Laufe der weiteren Ereignisse die rote und die blaue Pille ein. Hier aber hängt niemand an einer embryonal anmutenden Maschine; Hier folgt auf den Schlusssatz des ersten Kapitels ein provokantes, metafiktionales: So!?
So.
Warum denn nicht?
Das letzte Kapitel wird irgendwann geschrieben sein.
Meins.
Deins.
Seins.
Ihrs.
Unser aller. (16)
... oder doch nicht so?
Natürlich könnte jede erzählte Geschichte so oder auch ganz anders verlaufen. Und irgendwann im Roman wird auch der Workshop eines Autors mit Schiebermütze zitiert. „Wo wir mit diesen drei Techniken was-wäre-wenn-Prämissen entwickelt haben?“ (77) Ganz diesen Prämissen entsprechend, setzt das Erzählen neu an. Dreimal. Dabei entsteht kein Multiverse; sondern dieselben Ereignisse werden (im Präsens) dreimal neu erzählt. Jedesmal wird eine größere Zeitspanne gewählt, sprich: die Ereignisse setzen früher ein und werden fortgesetzt. Bereits erzählte Szenen werden im raffenden Futur eingefügt – oder aber neu und umfassender auserzählt, fortgesetzt, angefügt. Wenn Ich-Erzähler Kester also wie durch ein Wunder den Autounfall überlebt und sich nach Hamburg aufmacht, um dort in einen Club im Bunker zu gelangen, werden jene Figuren, auf die Kester im Verlauf der Nacht trifft, immer wieder neu aufgegriffen, Handlungsstränge fortgesetzt, Dialoge hinzugefügt. Jedes folgende Kapitel wächst dieserart auf doppelte Länge des vorangehenden Kapitels an. Kester taucht damit immer tiefer in dialogisch angelegte Gespräche über das Erwachsenwerden ein; es zeigt sich aber auch immer deutlicher, worin nun eigentlich der Grund dafür liegt, dass er mit seinem eigenen Leben abschließen wollte. Immer deutlicher zeigt sich, dass sein eigenes Schicksal an jenes seiner Schulfreundin Blanka gebunden ist – die Freundin auf dem Fotostreifen, von dem Kester sich auf seiner wilden Autofahrt nicht wie vom Schülerausweis und anderen Identitätsmarkern getrennt hat. Die Frau mit der Bienenkorbfrisur, die verloren gegangen ist. Die Freundin, die manisch liest, weil das eine Leben nicht genug ist. Die Freundin, deren Blog immer mehr Bedeutung erhält und das Rätselspiel um die Ereignisse dieser einen Nacht vorantreibt. Die Freundin, die die Frage stellt:
„Wer bist Du denn?
Auf die Kester antwortet:
„Das wüsste ich auch gerne. Vorschläge?“ (80)
Natürlich hat diese Frage – wir erinnern uns: wir befinden uns in einem Roman von Nils Mohl – nicht nur adoleszente Bedeutung. Sondern selbstverständlich auch erzähltheoretische, motivische und metafiktionale. Denn vom Ende des Romans her stellt sich die Frage danach, wer Kester ist, nochmals neu. Doch vielleicht von Anfang an: Kester, stets Klassenbester gerät mit seiner Idee des Eskalierens in einen Reigen kurioser Figuren: queere Paradiesvögel, Komiker, Dealer, Trainingshosen-Typen mit Neigung zur homophoben Gewalt, Businessladies mit Hang zum Etablissement. Kester, in der Schulzeit stets Klassenbester, scheint gerade jetzt mit dem Schwänzen beginnen zu wollen. Nicht die Schule, sondern das Leben selbst soll gecancelt werden und all die Leben, in die er sich in dieser Nacht involviert, bringen es mit sich, dass ihm aus erwachsener Sicht Erfahrungen ins Stammbuch geschrieben werden; dass sich gleichzeitig aber die unterschiedlichsten, zum Teil durchaus abenteuerlichen Möglichkeiten auftun, dem Leben (erneut) ein Ende zu setzen – während der Subtext aller Begegnungen lautet, dass es eigentlich nichts gibt, wofür es sich zu sterben lohnt. Aber wofür lohnt es sich zu leben?
Die Frage wird zunehmend an die kurioseste der auftauchenden Figuren gebunden – an Bruno. Er nämlich behauptet von sich, ein Engel zu sein. Und wer Nils Mohl bei seiner erzählerisch raffinierten Alien-Aktion in „Henny & Ponger“ gefolgt ist, sollte solche Ansagen ernst nehmen – zumal dann, wenn sie titelgebend für den Roman sind. Und wenn – ähnlich wie bei „Henny & Ponger“, aber doch ganz anders, am Beginn der ersten Version der letzten Nacht von einem Riss im Raumzeitgefüge (32) die Rede ist. Immer dichter werden die Hinweise darauf, dass nicht nur die drei Versionen einander überlagern, sondern auch unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten der immer dynamischer werdenden Ereignisse. Schließlich folgt man im und mit dem Roman nicht ohne Grund einer gekritzelten Spirale. Es gilt also, bis in den Kern des sich erst langsam aufbauenden, sich im letzten Teil aber deutlich beschleunigenden Erzähl-Tornado vorzudringen. Bis zu jenem zentralen Twist am Ende, von dem aus der Roman neu gelesen werden muss.
Dass die Lesarten dann individuell ganz unterschiedlich sein können, zeigen die folgenden drei Versionen.
Die nur lesen sollte, wer mit dem Roman selbst durch ist.
Denn ab hier wird gnadenlos GESPOILERT.
Also, noch mal vorn vorne …
Die letzte Nacht.
(Kathi-Version)
Meine Lesart des Buches: Hauptfigur und Ich-Erzähler Kester existiert eigentlich nicht, sondern ist vielmehr der imaginäre Freund von Blanka, jenes Mädchen, mit deren Auto er sich aufmacht nach Hamburg. Wie ich darauf komme? Bereits die Ebene der Buchgestaltung liefert dafür ein erstes Indiz, die hingekritzelten Kringel am Beginn der verschiedenen Versionen der Geschichte könnten darauf hinweisen, dass es eigentlich Blankas Notizbuch ist, das wir lesen. Recht spät im Buch treffen nach einer ereignisreichen Nacht Kester und Blanka wieder aufeinander. Nach einer Umarmung sind ihre ersten Worte an ihn: „Ich soll dir ausrichten, es ist noch zu früh“. (203). Auf Kesters Frage, wer das ausrichten lässt, antwortet sie: „Der Tod.“ Ich stelle mir vor, dass sie das ganz lapidar, ganz trocken sagt – in welcher Stimmung sie es sagt, wird nämlich im Text nicht auserzählt, wie uns ja überhaupt der Autor bei der Lektüre des Romans (wie diese polyphone Kröte zeigt) einiges an Arbeit überlässt. Das wirft natürlich die Frage auf, warum Blanka mit dem Tod so gut ist. Man könnte den Satz so lesen, dass der Tod meint, es sei für Kester noch zu früh, um sein Leben absichtlich zu beenden. Oder doch nicht so? Man könnte den Satz, mit dem Wissen um Blankas schwere Krankheit, nämlich auch so lesen: Es ist noch zu früh für ihr eigenes Sterben. Und damit auch für die Auflösung eines Wesens, das offenbar mehr mit ihrer Existenz zu tun hat, als wir das bei der bisherigen Lektüre vermutet haben. Kester selbst formuliert diese Ahnung kurz danach, auf Seite 208 so: „Du könntest mich auch einfach erfunden haben, Blanka.“ Anschließend wirft er, ausgehend von seinem Vornamen, mit Begriffen um sich, die mit K beginnen, darunter auch Kunstfigur. Diese Vermutung, dass sie ihn erschaffen hat, um mit ihrer Krankheit besser umgehen zu können, bestätigt sie wenige Seiten später:
„Ich werde sterben, K. Als mir das klar wurde, brauchte ich ganz dringend einen Kameraden in der Nähe, der mich versteht, der immer da ist. Zumindest in meiner Fantasie. Jemand, der schlau ist, der gut lernt. Der mir Kraft gibt, der sich ein bisschen in mich verliebt. Und dann hast du dich verselbstständigt.“ (210).
Das erklärt auch die verschiedenen Versionen der Geschichte: jemand, der eigentlich gar nicht existiert, in bester literarischer Tradition >>> ein imaginärer Freund ist, kann verschiedene Varianten ein und desselben durchleben, und: wer gar nicht lebt, kann auch nicht sterben. Und ist in einer besonderen Weise ein Wesen ohne Körper, ohne tatsächliche Verortung auf dieser Erde. Dieser Umstand erschließt sich offenbar Kester erst allmählich, seine letzten Worte sind:
„Der Engel der letzten Nacht, das war nicht Bruno, war nicht Blanka, niemand Unsichtbares, Überirdisches, auch keine Erscheinung, kein Wunschtraum, sondern das war wahrscheinlich ich, Kester, selbst – ich und ich allein.“ (215)
So ist es nur logisch, dass das letzte Kapitel, das tatsächliche „letzte Wort“ eben nicht Kester gehört, der im übrigen Text der Angelpunkt der Handlung war, sondern Bruno – denn wenn Kester, wie in meiner Lesart, Blankas fantastischer Gefährte ist (oder war?), ist er ja möglicherweise nach ihrer letzten Begegnung im Bunker nicht mehr da. Oder doch nicht so? „Wer ich bin, wird ein Rätsel bleiben [...]“ (214).
Der Überlebende.
(Xandi-Version)
In meiner Engelwelt stellt sich die Frage gar nicht: Kester ist am Leben und war auch nie nicht lebendig, aber rollen wir das Feld von hinten auf. Damit wäre die These, dass Kester nie das Reich des Todes betreten hat oder gar als unsichtbarer Freund durch Hamburg stromert für mich auch schon bewiesen:
Es wird mir, wie dir, wie ihm, wie ihr, wie uns allen langsam dämmern: Der Engel der letzten Nacht, das war nicht Bruno, war nicht Blanka, niemand Unsichtbares, Überirdisches, auch keine Erscheinungen, kein Wunschtraum, sondern das war wahrscheinlich ich, Kester, selbst – ich und ich allein. (215)
Und damit wäre die Beweislage schon abgeschlossen. Wäre aber natürlich feig, vor allem da andere Autorinnen dieser Kröte ebenjenes Zitat als Beleg ihrer These heranziehen. Es braucht nichts Unsichtbares und nichts Überirdisches, um jene Nacht so zu durchleben, wie es Kester getan hat, sondern nur ihn selbst. Wie er leibt und lebt. Im individuellen Leseprozess haben sich für mich andere Lesarten nicht erschlossen: Ob es an der Situation, in der man liest, liegt? Vielleicht. Ob unterschiedliche STUBE-Team-Frauen unterschiedliche Leseintentionen haben? Mit Sicherheit.
Für mich ist aber klar: Kester wird gesehen, gehört, gefühlt. Und zwar nicht nur von genial entworfenen Figuren, sondern auch von der Stadt Hamburg, die Nils Mohl in einem Werkstattgespräch als zweite Protagonistin des Romans bezeichnet. Im Gegenzug sieht, hört, fühlt auch er, Kester. Auch wenn zu Beginn Stille herrscht: Wie ein Riss im Raumzeitgefüge vielleicht. (32). Ein Riss, an dessen Stelle natürlich der Übergang vom Dies- ins Jenseits stehen könnte – zumal dem ein Autounfall vorangegangen ist –, aber ebenso ein Riss, den Kester in meiner Lesart zu überwinden weiß, wenn sich Umrisse wieder scharf stellen und die Hintergrundgeräusche wieder laut(er) werden. Mit der Geräuschkulisse nimmt dann auch die Handlung Fahrt auf und Kester wird als eine Figur in das Hamburger Nachtleben gestellt, die ungeheures Glück hat, und wichtiges Gegenüber wird: Für Kim, Lenny, Christina, Blanka, Bruno und letztendlich für sich selbst. Insbesondere dann, wenn durch die Gespräche und haptische wie visuelle Begegnungen mit den anderen Figuren das Leben in unterschiedlichem und neuem Licht erscheint.
Aber was hat es dann mit dem Engel auf sich? Und mit der letzten Nacht? Nun ja, irgendeine Nacht wird die letzte sein und gleichzeitig kann jede Nacht DIE letzte sein. Ähnlich wie Mauser in „Es war einmal Indianerland“ einen Häuptling sieht, ist es für mich hier Bruno, der als Engel inszeniert wird und sozusagen als Orientierungsinstanz und wiederkehrende Konstanze in dieser verrückten Nacht in Hamburg für die jugendliche Figur dienen kann – natürlich mit dem Unterschied, dass er von allen und nicht nur von Kester gesehen wird. Und warum bezeichnet sich Kester selbst als Engel der letzten Nacht? Für mich ist es sprichwörtlich gemeint á la „Du bist ein Engel auf Erden, der für andere da ist“. In seinem Dasein als Gegenüber von unterschiedlichen Figuren, denen er hilft und durch die er sich letztlich auch selbst helfen kann.
Der Engel.
(Heidi-Version)
Mit dem Riss im Raum-Zeitgefüge, das eintritt, als die Tonspur nach dem Autounfall auf Stille gesetzt wird, ist eine Irritation markiert, die sich im weiteren Verlauf des Romans nicht nur fortsetzt, sondern auch an unterschiedlichen Stellen im Sinne einander überlagernder Wahrnehmungsebenen expliziert wird: Seelensammler, ein Pale Blue Dot, Morpheus Angebot an Neo, Spiegeleffekt und optische Illusionen, die Engelflügel zeigen, dienen dem unzuverlässigen Erzählen.
Eine verirrte Feder.
Vielleicht von einer Taube.
Es gibt für alles immer Erklärungen.
Ich ignorierte das weiße Etwas einfach. (168)
Bruno behauptet, ein Engel zu sein – und trägt wohl nicht ohne Grund den Vornamen eines Schauspielers, der für die intensivste und berührendste Engel-Darstellung der Filmgeschichte sorgte. Doch anders als der von Bruno Ganz verkörperte Damiel in der „Himmel über Berlin“ scheint dieser Bruno über eine manifeste Körperlichkeit zu verfügen. Warum aber sollte das die Möglichkeit ausschließen, dass wir es im Roman mit einem Engel zu tun haben? Unendlich viele Engel passen auf die Spitze einer Nadel heißt es über die Geschöpfe, die menschenähnliche Gestalt haben können, deren Wesen aber nicht durch ihre Existenz oder ihr (kulturell determiniertes, geflügeltes) Erscheinungsbild bestimmbar ist, sondern durch ihr Sein als Boten: Der Engel vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags, denn seine Existenz ist die Botschaft.
Nils Mohl legt Bruno dieses Zitat des Theologen Claus Westermann in den Mund und verdichtet darin die von Bruno an Kester übermittelte Intention, eine verzweifelte Seele zu retten, um als Engel Frieden zu finden. So wie er die weiße Feder ignoriert, ignoriert Kester über lange Strecken des Romans auch die Aufgabe, die nicht nur Bruno, sondern auch ihm gestellt ist. Er schluckt die blaue Pille, verbleibt in der Welt der Illusion, den Autounfall überlebt zu haben. Der Riss im Raum-Zeit-Gefüge ermöglicht es ihm, durch die Nacht zu streifen, auf Figuren zu treffen, deren Aufgabe es scheinbar ist, Kester von seinem Vorhaben abzuhalten, diese Nacht zu seiner letzten, in ihrer Party-Qualität letztgültigen zu machen. Erst mit dem wiederholten Auftauchen von Bruno springt das Moment der Erkenntnis auch auf Kester über: Ich bin nicht allein, war es nie. / Ich tanze ... (202)
Dieser Tanz meint eine Existenz jenseits von Raum und Zeit; er meint eine Existenz, durch die Kester selbst sich in das Leben anderer involviert – und es damit verändert. Dieser Tanz meint jene Spiral-Dynamik, die Blanka für sich beansprucht, die aber nur Kester ihr ermöglicht, indem er zu ihrem Gegenüber wird. Zu ihrem Dialogpartner. Was Kathi in ihrer Version metafiktional liest, und der Roman als Deutungsmöglichkeit im letzten Dialog zwischen Kester und Blanka auch grundlegt, wandelt sich mit dem Ende des Romans aus meiner Sicht zu einer nicht metafiktionalen, sondern metaphysischen Deutung:
Und dann geht alles sehr schnell. Wie das Zittern einer Seifenblase vor dem Platzen. Wie das Platzen selbst. (211)
In diesem Moment ziehen Zeit und Raum sich zusammen, hier und jetzt, morgen und woanders, überall und immer. Der Moment, in dem Kester mit dem roten Signallicht am Balkon des Bunkers steht und zum Wegweiser unterschiedlicher Leben wird, ist deckungsgleich mit dem Moment, in dem mit dem Autounfall Stille eintritt. Davor aber setzt für die Dauer von kosmisch unbedeutenden Zeiträumen das Geschehen einer Nacht ein, in der es nicht darum geht, vor dem Hintergrund der Adoleszenz zu klären, wer Kester ist. Er wird als Mensch ein Rätsel bleiben, doch zwischen Leben und Tod wird er, Kester, selbst zum Engel der Nacht werden.
Das Kröte-des-Monats-Logo können Sie hier für Werbezwecke in unterschiedlichen Formaten downloaden.
>>> jpg
>>> png
>>> gif
>>> hier geht es zu den Kröten 2025.
Die gesammelten Kröten der letzten Monate und Jahre finden Sie im >>> Krötenarchiv
