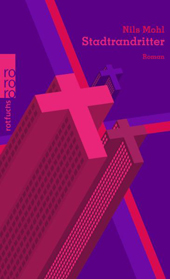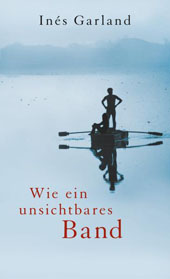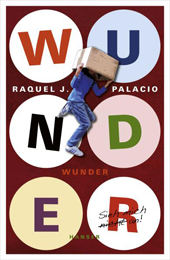Thema: Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2014

Preisträgerin
Claude K. Dubois: Akim rennt
Hundert Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs herrscht im uns umgebenden europäischen Gebiet relativer Friede. Dennoch setzt sich jene historische Urkatastrophe der Moderne, als die der Erste Weltkrieg heute rezipiert wird, auf persönlicher Ebene für zahllose Menschen auf allen Kontinenten durch ihre Erfahrungen von Krieg und Flucht fort. Die belgische Künstlerin Claude K. Dubois versucht diese traumatischen Erfahrungen am Beispiel des individuellen Schicksals des jungen Akim für Kinder erfahrbar zu machen. Ihr Blick richtet sich dabei auf die Krisenregion des Kaukasus – wobei dabei viel weniger eine konkrete zeitgeschichtliche Verortung, als vielmehr eine Lenkung des Blicks auf die Peripherien des Weltgeschehens vorgenommen wird. Wenn jeder Christ und jede Christin aufgefordert ist, den Mut zu haben, Randgebiete zu erreichen, wie Papst Franziskus es so nachhaltig in "Evangelii Gaudium" formuliert, liegt der Beginn unseres davon bestimmten Handelns in der Fähigkeit, das menschliche Erleben jener zu begreifen, die aus dem geordneten Miteinander herausfallen. Das gilt auch und insbesondere für Kinder, deren ethisches und religiöses Handeln sich erst herausbildet.
Doch wie eine Sprache für das Unaussprechliche finden? Claude K. Dubois wählt das Mittel der Bildsprache: Sie arrangiert skizzenhaft festgehaltene Momente zu einer Bildgeschichte und folgt in deren Sequenzierung der Bewegung von Akims Flucht.
Wie eine Naturgewalt kommt der Krieg über das schlichte Leben des Jungen, als ein aschefarbener Wirbelsturm am Horizont auftaucht und ihm erste Detonationen folgen. Irritiert bleibt Akim in der Trümmerlandschaft zurück, bis er unvermittelt an der Hand genommen und mit Flüchtenden mitgerissen wird. Dann jedoch passiert, was Akims weiter Geschichte bestimmt: Er verliert die Hand jenes Erwachsenen, an den er sich geklammert hat und bleibt wortwörtlich mutterseelenallein zurück. Von diesem Moment an fokussieren die Bilder auf die Einsamkeit und das Verlorensein Akims, der in ganz unterschiedliche Szenarien des Kriegsgeschehens gerät. Als würde sie das Geschehen dokumentarisch begleiten, hält die Illustratorin diese Szenen in ihren Bleistiftzeichnungen fest, die in ihrem raschen Strich den jeweils einzelnen Moment zu fassen und zu konservieren versuchen – und ihn dennoch in seiner Flüchtigkeit belassen. Als Akim sich einer Flüchtlingsgruppe anschließen kann, werden diese Momentaufnahmen zunehmend als modernes Exodusgeschehen lesbar – wobei das Meer sich nicht teilt, sondern überfüllte Flüchtlingsboote an neue Ufer gelangen wollen.
"Rette mich, Herr, mit deiner Hand vor diesen Leuten, vor denen, die im Leben schon alles haben", heißt es in Psalm 14. Mit den Geschehnissen im Flüchtlingslager rückt Claude K. Dubois ihre Geschichte ins Zentrum medialer Alltagserfahrungen der westlichen Welt und zeigt auf berührende Weise das Ausmaß der Trauer, die Akims Leben bestimmt: Egal ob inmitten anderer Kinder, im Spiel oder alleine in den Bildraum gesetzt – er vermisst sein früheres Leben und seine Eltern.
In der Traumatherapie ist es wichtig, die Aufarbeitung existentieller Erlebnisse dieser Art immer positiv einzubetten. Und so wird auch hier Akims Erleben von einem harmonischen Beginn und einem versöhnlichen Ende umrahmt: In der letzten Bildsequenz findet Akim seine Mutter wieder – und mit ihr jene Heimat, Geborgenheit und Zugehörigkeit, auf die jedes Kind ein Recht haben sollte.
Heidi Lexe
Aus dem Französ. v. Tobias Scheffel.
Moritz 2013.
96 S.
Ehrenliste 2014
Nils Mohl: Stadtrandritter
"Woran glaubst Du?" Dieser Frage folgend, erzählt Nils Mohl von jugendlicher Sinnsuche in einer fragmentierten Welt. Er lenkt den Blick an die Peripherie einer Hochhaussiedlung. Dort versuchen Silvester Lanzen und Merle von Aue, aus deren Sicht abwechselnd erzählt wird, sich über die Zielsetzungen ihres je eigenen, aber auch eines möglichen gemeinsamen Lebens klar zu werden. Der Bogen wird dabei vom paradiesischen Miteinander der ersten Annäherung bis zum apokalyptischen Ende geschlagen, an dem ihre Hoffnungen in Flammen aufgehen – und mit ihnen jene Pfarrei, die zum sozialen Mittelpunkt des Romans wird. Um den ovalen Beistelltisch des Pastors gruppieren sich die Knappen, die ihre individuellen Âventiuren zu bestehen haben. Zum Gral wird die Suche nach der Wahrheit – insbesondere jener nach den Ereignissen am Todestag von Silvesters Schwester. Bereits in "Es war einmal Indianerland" hat Nils Mohl eine Erzählweise etabliert, in der szenische Bruchstücke sich aneinanderreihen und Sinnzusammenhänge sich erst aus dem Gesamtbild eröffnen. Nach der dort thematisierten Liebe folgt in der geplanten Trilogie nun der Glaube und erneut werden zahlreiche mediale Verweise, aber auch biblische Zeichensetzungen genutzt, um adoleszenten Figuren an den Bruchlinien ihres Lebens herauszufordern.
Rowohlt 2013.
678 S
Inés Garland: Wie ein unsichtbares Band
Die argentinische Autorin richtet den erzählerischen Blick auf einen scheinbar paradiesischen Ort – eine Insel im Fluss, außerhalb von Buenos Aires. Langsam jedoch sickert die Realität in dieses Paradies ein und verändert auch die Beziehungen der Figuren, die die Insel miteinander verbindet: Der Roman folgt Alma, dem reichen und urbanen Mädchen, die ihre Wochenende und Ferien hier verbringt, und ihrer Freundschaft zu den Inselkindern Carmen und Marito. Die unterschiedlichen Zeitebenen jedoch fließen ineinander, wenn kindliches Glück, Verrat an der Freundin und eine beginnende Liebe sich zu einem sprachlich dicht gewebten Kaleidoskop fügen. Die Leser*innen nehmen den naiven Blick von Alma ein und erkennen erst nach und nach, dass nicht nur soziale Unterschiede, sondern auch ganz deutliche politische Positionen den Wunsch nach dem paradiesischen Heil-Sein untergraben. Denn zeitlich wird der Roman in den 1970er Jahren vor dem Beginn der Militärdiktatur verortet und Marito schließt sich der Widerstandsbewegung an. Damit radikalisieren sich auch die Ereignisse. Alma erzählt vom Ende ihrer Geschichte her, ordnet Ereignisse ein, lässt Erkenntnisse aus der späteren Zeit in die früheren Erlebnisse einsickern und erzählt dennoch unmittelbar aus ihrem kindlichen und jugendlichen Erleben heraus. Und schafft somit den Sprachraum, der Glück, Traurigkeit, Einsamkeit und Hoffnung gleichermaßen Platz gibt.
Aus dem Argentin. v. Ilse Layer.
FISCHER KJB 2013.
248 S.
Raquel J. Palacio: Wunder
Das Wesen der inneren Schönheit zu beschwören ist nicht leicht, wenn man so aussieht wie der 10-jährige August: Sein Gesicht ist aufgrund eines Gen-Defekts entstellt. Der Roman setzt ein, als Augie erstmals eine öffentliche Schule besuchen soll und folgt wortwörtlich den unterschiedlichen Blicken, die auf August geworfen werden. Wie korrespondieren Fremd- und Selbstwahrnehmung, wenn die Unsicherheit darüber, wie miteinander umzugehen ist, zum bestimmenden Moment wird? August ist kein selbstsicherer Außenseiter, weiß aber dennoch mit viel erzählerischem Witz, seine Situation zu beschreiben. Die Form des multiperspektivischen Erzählens jedoch zeigt, wie aus Gedankenlosigkeit Missgunst erwächst und Loyalitäten auf die Probe gestellt werden. Subtiles Mobbing und offenes Eintreten füreinander werden dabei gleichermaßen relevant. Kurze Textpassagen, unterschiedliche Textsorten, zahlreiche Zitate aus der Populärkultur: Die amerikanische Autorin verortet die erzählte Lebensvielfalt in einer variantenreichen Erzählwelt, zu deren integrativen Bestandteilen auch eine gehörige Portion Pathos zählt. Fortgesetzt wird diese Vielfalt in einem mit dem 1. deutschen Kinderhörbuchpreis BEO ausgezeichneten Hörbuch, in dem Andreas Steinhöfel im auch stimmlich multiperspektivischen Setting Augie seine Stimme leiht.
Aus dem Engl. v. André Mumot.
Hanser 2013.
381 S.
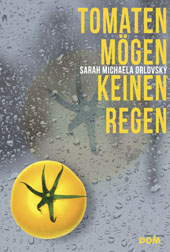
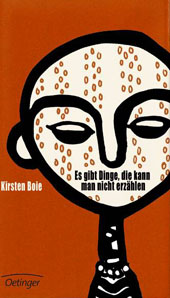
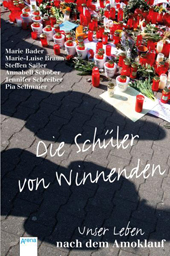
Sarah Michaela Orlovský: Tomaten mögen keinen Regen
"Das Haus Betlehem ist ein besonderes Zuhause für besondere Kinder." So formuliert es Redakteurin Ana, die eine "Behinderten-Story" über ein Waisenheim schreiben möchte. Gaya, Bewohnerin des Heims, ist da pragmatischer: "Ein Waisenheim ist halt ein Waisenheim." Bereits mit diesen unterschiedlichen Beschreibungen des zentralen Handlungsortes lotet Sarah Michaela Orlovský den Begriff "Normalität" neu aus. Der jugendliche Ich-Erzähler Hovanes erzählt ganz unmittelbar von dieser Lebensrealität, von seiner Arbeit im Garten, den Schwestern und Kindern im Haus, seiner Zuneigung zu einem Mädchen von draußen ... Als reflektierter Erzähler trägt Hovanes schwer am Bewusstsein, "anders" zu sein, sein Wunsch nach Selbstbestimmung ist im ständigen Zusammensein mit jüngeren Kindern schwer zu verwirklichen. "Das Haus gehört allen, der Garten gehört allen, wir essen und beten und atmen zusammen." Trotz dieses hermetischen Schauplatzes gelingt es der Autorin, Diversität zu transportieren und das Heim als komplexes Kollektiv zu gestalten. Dabei charakterisiert sie die Figuren ohne oberflächliche Zuschreibungen und verweigert sich einer eindeutigen Einordnung ihrer scheinbaren Handicaps.
Wiener Dom-Verlag/Tyrolia 2013.
176 S.
Kirsten Boie: Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen
Wie viel vermag der Mensch zu ertragen? Und wovon lässt sich literarisch sprechen? Kirsten Boie findet einen ganz eigenen Sprachrhythmus, wenn sie sich sprachlich geradlinig und schmucklos unterschiedlichen Kinderschicksalen annähert. Begreifen lässt es sich nicht, was diese Kinder zu durchleben haben. Aber erst das Wissen darum ermöglicht karitatives Handeln.
Es sind vier Geschichten, verortet in Swasiland, jenem südafrikanischen Binnenstaat, in dem nur eine Million Menschen lebt. Darunter jedoch über 120.000 Kinder, die mindestens einen Elternteil an das HIV-Virus verloren haben. Die Lebensbedingungen von Mädchen und Buben solcher Kinderfamilien bilden den erzählerischen Rahmen, wenn die gesamtgesellschaftliche und politische Situation des Landes in Einzelschicksalen gespiegelt wird. Nicht das Bildungssystem an sich, sondern das Scheitern an banalen Notwendigkeiten wird zum Erzählinhalt, wenn unterschiedliche Versuche gezeigt werden, Geschwistern einen Schulbesuch zu ermöglichen. Die bittere Wahrheit einer verarmten Existenz wird dabei nicht ausgespart: Oft überlebt nur derjenige, der sich selbst oder andere verrät oder verkauft. Implizit wird die Frage nach dem Leben in einer gottlosen Welt gestellt, in der die Kinder selbst ihre erlösende Kraft entwickeln müssen.
Ill. v. Regina Kehn.
Oetinger 2013.
115 S.
Die Schüler von Winnenden. Unser Leben nach dem Amoklauf
In der erzählenden Sachbuchreihe "Mein Leben" fällt der Fokus diesmal auf die radikale, existentielle Bedeutung des Überlebens, wenn fünf Jugendliche unterschiedlichen Alters und eine ehemalige Lehrerin der Alberville-Realschule ihre Erinnerungen an jenen Amoklauf festhalten, bei dem 111 Schüsse aus einer großkalibrigen Pistole fielen. Zueinander gestellt werden kurze Passagen, die am Tag davor einsetzen, die Geschehnisse des 11. März 2009 selbst, vor allem aber die Zeit danach in den Blick nehmen – eine Zeit, die vom Medienansturm auf Winnenden ebenso bestimmt war, wie von Angst, von Trauer, von Albträumen, vom Versuch, in ein Leben danach zurück zu finden. Neun Schüler*innen und drei Lehrerinnen starben – und natürlich kann dabei nicht vom spontanen Ausrasten eines ehemaligen Schülers gesprochen werden. Vielmehr müssen die Ereignisse als gezielt geplante Gewalttat verstanden werden. Der Schreckensschrei der Schwester eines der getöteten Mädchen hallt durch das gesamte Buch nach, wenn die Erinnerungen und Reflexionen der Überlebenden weit über den Tag des Geschehens hinausführen und individuelle Eindrücke vom Durchleben der Ereignisse sich zu einem eindrücklichen Bild physischer, vor allem aber psychischer Verletzungen verdichten.
Maria Bader, Marie-Luise Braun, Steffen Sailer, Annabell Schober, Jennifer Schreiber, Pia Sellmaier.
In Zusammenarbeit mit Daniel Oliver Bachmann.
Arena 2013.
162 S.
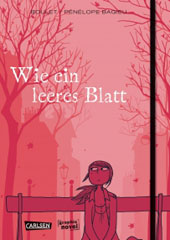
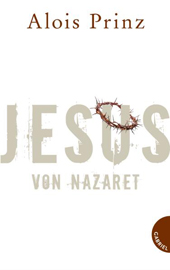
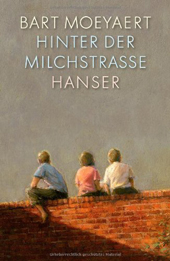
Boulet / Pénélope Bagieu: Wie ein leeres Blatt
Was Eloïse in dieser Graphic Novel widerfährt, ist eine Tabula rasa der besonderen Art: Auf einer Parkbank sitzend weiß sie plötzlich nicht mehr, wer sie ist. Mit detektivischem Spürsinn beginnt mit dem Inhalt ihrer Handtasche die Rekonstruktion eines Lebens. Die Panels folgen eng Eloïses Wahrnehmung und erzählen gleichsam komisch wie tiefgründig, mit welcher Akribie sie sich selbst erforscht. Dabei spaltet sich die Figur auf: In jene junge Frau, deren Charakter sich aufgrund der Umgebung und persönlichen Gegenstände erschließt, und die Eloïse ohne Gedächtnis, die sich nur allzu oft über sich selbst wundert. Sichtbar wird diese Diskrepanz auch im Sprachgebrauch, wenn Eloïse von sich selbst in der dritten Person spricht, aber auch im Subtext der Erzählung, wenn zunehmend sichtbar wird, dass ihr die alte Identität einfach nicht mehr passt. Denn die Frau, die Eloïse in ihren Recherchen erkennt, scheint nicht glücklich gewesen zu sein ... Dass der spannenden Suche nach Identität keine finale Enthüllung des Grundes ihrer Amnesie folgt – oder gar ein Erinnern – tut dieser großartigen Graphic Novel mit französischem Chic keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Der Schlussakkord stimmt den Text noch einmal raffiniert um – und deutet Eloïses Amnesie nicht als Verlust, sondern als Chance.
Ill. v. Pénélope Bagieu.
Aus dem Französ. von Ulrich Pröfrock.
Carlsen 2013.
201 S.
Alois Prinz: Jesus von Nazaret
Das Konzept von historischer "Wahrheit" ist stets relativ – denn über das Wesen eines Menschen können erfundene Geschichten unter Umständen mehr aussagen als "reale". Wenn es nun um eine Biographie von Jesus geht, stellen sich solche Fragen in besonderer Weise, ist hier doch die Kluft zwischen dem, was tatsächlich historisch mit Quellen belegbar ist und dem, was an Geschichten, Deutungsversuchen und exegetischen Interpretationen vorliegt, groß. Der Bogen zwischen der 2000 Jahre zurückliegenden Vergangenheit und der Gegenwart wird hier gekonnt gespannt: Wie sehen die Schauplätze von bekannten Evangelienstellen heute konkret aus und was kann deren Botschaft für Menschen heute bedeuten? Fachkundig werden wenig bekannte sozialhistorische Hintergründe beleuchtet und theologische Fachdiskurse prägnant und verständlich zusammengefasst: "'Wahrer Mensch und wahrer Gott' – diese Formel ist weniger eine Lösung als eine Aufgabe." So zeigen sich facettenreiche Aspekte eines Lebens, von dem man meint, schon alles gehört zu haben, und doch letztlich so wenig weiß.
Gabriel 2013.
236 S.
Bart Moeyaert: Hinter der Milchstraße
"Der Wind hielt die Luft an." Es ist ein sommerliches Moratorium, das der flämische Erfolgsautor in seiner unvergleichlich genauen Sprachgebung in den Blick nimmt. Sein Erzählen folgt Oskar, der die sommerliche Zeit mit seinem älteren Bruder und der gemeinsamen Freundin Geesje auf einer Mauer vor einem Eisen-Altwaren-Hof herumzubringen versucht. Während die Hitze flirrt, sorgen minimale Verschiebungen im prekären Gefüge der Figuren, in dessen Mitte Oskar gestellt wird, für kindliche Irritation, Sehnsucht und Kummer. Figuren tauchen auf oder tauchen unvermittelt ab; sie hinterlassen Leerstellen oder werfen ganz neue Fragen ins Oskars Leben auf. "Scheißzeug" würde Oskars Bruder es nennen, doch der stille Oskar vermag im Nachdenken und Beobachten den Weg über die metaphorische Milchstraße zu gehen, die sich zwischen den Polen des Weltalls spannt. Faszinierend genau und sehr umsichtig formuliert Bart Moeyaert, wenn er auch die kleinsten Bewegungen und Gedanken in den Blick nimmt. Und entwirft damit ein ganz besonderes Bild von Kindheit abseits der multimedialen Alltagsaction.
Aus dem Niederländ. v. Mirjam Pressler.
Hanser 2013.
150 S.
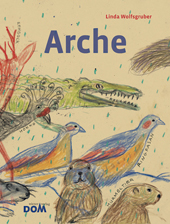
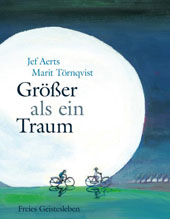

Linda Wolfsgruber: Arche
Biblische Erzählungen gehören zum kulturellen Grundbestand unserer Gesellschaft, zeichnen sich in ihnen doch zentrale menschheitsgeschichtliche Fragestellungen ab. Die Geschichte von der großen Flut erzählt von einem Neubeginn der Welt: Die Bosheit der Menschen wird ins Chaos rückgeführt, daraus entsteht ein neuer Bund mit Gott."Und so wurden alle gerettet!", heißt es auch folgerichtig im fast textlosen Bilderbuch von Linda Wolfsgruber, in dem die biblische Geschichte mit künstlerischen Mitteln auf deren zentrale Motive reduziert wird.
Hier stellen sich die Tierchen nicht in hübschen Zweierreihen an, sondern visualisieren eben jenes Chaos, aus dem die Schöpfung neu geboren wird: In wildem Strich und ebensolcher Farbgebung drängt Getier aller Art in eine Richtung: zur Arche! In pastellener Farbintensität werden in den Monotypien die Figuren übereinander geschoben. Als einziges Ordnungssystem erscheint die Benennung der Tiere – doch auch sie fügt sich als Bildelement in das dynamische Geschehen der Buntstift-Skizzen. Als das Ziel endlich erreicht ist, hat die Welt sich in wässrig-dunklem Blau und Grün eingefärbt und parallel zum Aufgehen der Sterne öffnen sich auch die Augen der Tiere – hoffnungsvoll.
Wiener Dom-Verlag/Tyrolia 2013.
26 S.
Jeff Aerts: Größer als ein Traum
Nicht vom Tod als punktuellem Ereignis, sondern vom Leben mit einem schmerzlichen Verlust handelt dieses Bilderbuch. Der Ich-Erzähler und Protagonist ist ein kleiner Bub, der seine große Schwester nie kennengelernt hat. Er kennt nur die Trauer, die ins Familienleben und den Alltag seit ihrem Tod fest eingewebt ist und ihr Foto an der Wand neben seinem. Eines Tages aber, als er gerade Marzipan nascht, spricht ihn seine Schwester an: "Niemand ruft so leise wie meine Schwester. Ihr schrillster Schrei ist nur ein Seufzer." In der folgenden Nacht besucht ihn die Schwester. Sie unternehmen einen Fahrradausflug, besuchen den Friedhof, das Spital, einen Park; rudern über einen See und schlafen aneinander gekuschelt ein. Während dieses nächtlichen Ausfluges ist Zeit für Sorglosigkeit und Vertrautheit zwischen Geschwistern, aber auch für Trauer und ein offenes Gespräch über den Tod. Am nächsten Morgen erzählt der Bub seinen Eltern von der Begegnung mit der Schwester: Das war größer als ein Traum. Abschied und Trauer als Bestandteile des Lebens – diese Themen werden auf der Bildebene, die die Texterzählung um manche Details erweitert, zurückhaltend und stimmig umgesetzt.
Ill. v. Marit Törnqvist.
Aus dem Niederländ. v. Marianne Holberg.
Freies Geistesleben 2013.
40 S.
Anne Hofmann: Osman, der Angler
Osman, der Angler kommt in seinem Bilderbuch selbst nicht zu Wort. Lediglich ein geduldiges Nicken hat er am Ende für die zwei geschwätzigen Vögel über, die den Text für sich in Anspruch nehmen: "Wir hatten nur einen Gedanken: Fisch!" Zwei freche wie hungrige Möwen begleiten Osman und kommentieren dessen Angelversuche. Im Kontrast zu diesem so gar nicht stimmungsvollen Gejammere der beiden Vögel stehen Bilder, die einen nachdenklichen Angler zeigen, der seine Besinnlichkeit auf die Stadt zu übertragen scheint. "'Was,' so fragen die Möwen zunehmend panisch den seelenruhigen Osman, 'angelst du eigentlich?'" Ohne Kommentar gelingt es dem Angler mithilfe der geangelten Gegenständen das Staunen der Menschen zurückzuholen: "Alle entdeckten etwas in dem Haufen: Erinnerungen, Träume, zauberhafte Gegenstände." Die anziehende Wirkung, die von den revitalisierten Artefakten auszugehen scheint, spiegelt sich in Anne Hofmanns Bildwelt wider. Die farblich abgestimmte Symbiose von Nacht, Meer und dem verheißungsvollen Schimmern der Gegenstände vermittelt ein verheißungsvolles Gefühl, das auch ohne Worte zustande kommt.
Aladin 2013.
28 S.
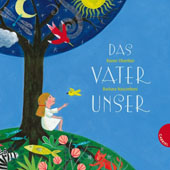

Rainer Oberthür: Das Vaterunser
Das Vaterunser verbleibt oftmals als viel gehörte, viel wiederholte Formel, deren Bedeutung sich Kindern (und Erwachsenen) nicht immer ganz erschließt. Rainer Oberthür setzt an, einem den Sinn dieser Gebetsverse wieder nahezubringen. Der*Die Leser*in – im Text als Du adressiert – wird mit Fragen nach der Welt und dem Leben abgeholt und langsam an das Vaterunser herangeführt. Der Text wird als Möglichkeit zu einem Gespräch mit Gott präsentiert. Die einzelnen Verse des Gebets werden auf je einer Doppelseite textlich und bildlich interpretiert und verständlich gemacht. Der eingehenden Erläuterung der einzelnen Verse folgt eine Art kulturgeschichtliche Einordnung. Der Erzählbogen endet mit einer zweiten, lebensnäheren Formulierung des Ausgangsgebets. Die Illustratorin Barbara Nascimbeni greift einzelne Aspekte heraus – besonders schön ist die Illustration zur Verszeile "Dein Wille geschehe": Ein Mädchen geht ihren eigenen Weg, bleibt aber im Umriss von Gottes Hand. Es sind reizvolle Interpretationen, die Denkanstöße und neues Verständnis anbieten.
Ill. v. Barbara Nascimbeni.
Gabriel 2013.
56 S.
Oscar Brenifier: Was, wenn Gott einer, keiner oder viele ist?
Wenn eine futuristisch anmutende Figur mit Haube in computeranimierter Ästhetik auf der einen Seite eine einzelne leuchtende Glühbirne, auf der anderen eine Vielzahl an glimmenden Leuchtstäben betrachtet, handelt es sich um einen weiteren Philosophie-Band aus Oscar Brenifiers Reihe. Dieses Mal: "Manche denken, dass es nur einen einzigen, einzigartigen und allmächtigen Gott gibt ... Andere glauben, dass es unzählige, ganz unterschiedliche Götter gibt." Ganz ohne religiöse oder konfessionelle Einschränkung werden die wichtigsten Gedanken rund um das Thema Gott pointiert formuliert: Wer ist Gott? Wo ist Gott? Und warum eigentlich überhaupt Gott? Relevante Thesen werden simpel präsentiert und vielfältige Fragen aufgeworfen, die ohne kategorisierende Antworten verbleiben und damit auch jeglichen belehrenden Impetus entbehren. Die humorvollen Illustrationen interpretieren und vertiefen diese kurzen Sinnsprüche. So kann nicht nur über den Text sinniert, sondern auch über die eine oder andere Bildsituation gegrübelt werden. Wie gewohnt schließt auch dieser Reihentitel mit einem "Und du?" und provoziert damit Reflexion und Gespräch.
Ill. v. Jacques Després.
Aus dem Französ. v. Anja Kootz und Tobias Scheffel.
Gabriel 2013.
28 S.