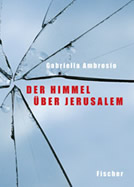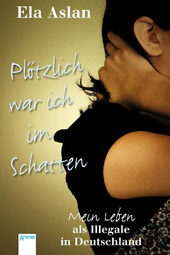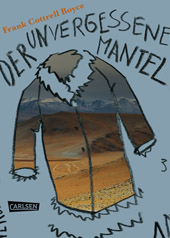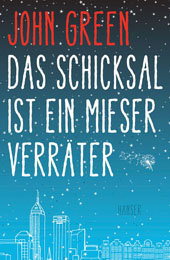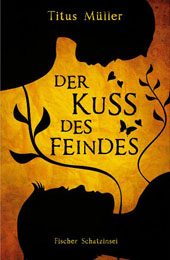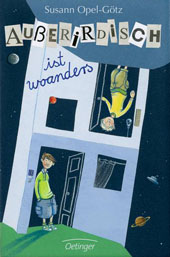Thema: Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2013

Preisträgerin
Tamara Bach: was vom sommer übrig ist
Die Kindheit gilt als Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Für Louise und Jana ist diese Zeit vorbei: Jana wird 13 Jahre alt und ihre Eltern vergessen auf ihren Geburtstag. Die 17jährige Louise hat ein bitteres Schuljahr hinter sich und versucht sich nun, im Sommer, mit einem Übermaß an Aktivität abzulenken. Ihr Wünsche auszusprechen, ist den beiden Mädchen nicht möglich, denn: Wem gegenüber sollten sie das tun? Die junge deutsche Autorin Tamara Bach lässt die introspektiven Stimmen der beiden Mädchen wie zwei Melodien anklingen, die ineinander greifen und letztlich zu einer Melodie werden, denn das Gefühl des verlassen Seins als tiefgreifende schmerzliche Erfahrung wird übergeführt in ein Miteinander, das den Stillstand aufhebt und Bewegung in Aussicht stellt.
Beide Mädchen leben im Schatten des Krankenhauses, im Schatten eines Un-Ort also: Louises Eltern arbeiten im Krankenhaus und versuchen sich ihre Dienste so einzuteilen, dass immer einer der beiden zu Hause bei der Tochter ist. Die Dienstzeiten und die daraus resultierende Erschöpfung jedoch führen dazu, dass Louise allein mit Schlafenden lebt; die konsequent jugendliche Erzählhaltung hat zur Folge, dass diese Eltern nie zu Wort kommen. Janas Eltern hingegen sprechen sehr wohl mit ihr – und dabei immer an ihr vorbei, denn der Fluchtpunkt allen familiären Handelns ist Tom, Janas Bruder, der in diesem Krankenhaus im Koma liegt, nach jener Sache … Auf literarisch virtuose Weise erfährt man, was damit gemeint ist, wenn Jana erzählt, wie mühsam mittlerweile ein Supermarktbesuch mit all den verhaltenen Fragen und getuschelten Vermutungen hinter den Regalreihen ist.
Wie zwei Himmelskörper, die aus ihrer Umlaufbahn geraten sind, stoßen die beiden Mädchen aufeinander; der Aufprall setzt einen Sternenregen aus Wünschen frei, als sie sich einen Tag Sommer gönnen und dabei ein umfassendes gedankliches „als ob“ inszenieren.
„Und dann wünsche ich mir, dass das nie wieder anders wird. Am liebsten soll die Zeit stehenbleiben, und wenn sie dann doch weitergeht, dann soll alles wieder gut sein, dann soll Tom leben und wach sein und auch wollen.“ Aber Tom stirbt und Jana zieht sich ganz in sich zurück. Das gemeinsam utopierte Glück jedoch ermöglicht es Louise, Jana in einer Art Rollenspiel aus ihrer Einsamkeit herauszulocken. Die beiden Mädchen sind einander ein Stück Heil im christlichen Sinn und verweisen damit auf eine literarische Übersetzung von religio: Sie verbinden sich miteinander, sie ermöglichen es einander, zugehörig zu sein und lindern damit den empfundenen Schmerz. Selten wurde das zutiefst religiöse Moment des Trostes literarisch so eindrücklich formuliert. Tamara Bachs sprachliches Mittel dafür ist das Moment der Verdichtung. Den spezifischen Rhythmus ihres literarischen Sprechens, den Wechsel zwischen Satzschleifen und knappen Dialogen, Ellipsen, Einwortsätzen und sichtbar gemachten Gedankensprüngen nutzend, komprimiert sie das Erleben von Louise und Jana auf wenige Situationen während eines Sommers. Sie lässt das emotional Unaussprechliche unausgesprochen und ermöglicht damit jene Leerstellen, die einem religiösen Moment auch dann literarisch Raum geben, wenn es nicht intendiert ist. Die beiden Mädchen empfinden jene Sehnsucht, die auch die Emmaus-Jünger empfinden: die Sehnsucht danach, dass die Ereignisse gestoppt werden und doch alles in Fluss kommt. "Und jetzt gehen wir, bis uns was anderes einfällt. Aber erst mal gehen wir."
Carlsen 2012.
Empfehlungsliste
Gabriella Ambrosio: Der Himmel über Jerusalem
"Geh in den Supermarkt und drück den Knopf!" Ein Roman, der die Stunden vor dieser Tat zeigt und wie in einem Mosaik beteiligte und betroffene Personen eines Selbstmordattentats in Jerusalem arrangiert: Im Mittelpunkt die Palästinenserin Dima, die unter Repressionen aufwächst und zur Täterin wird; sowie die Jüdin Myriam, die zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Kapitel, die auf jeweils eine Figur fokussieren und Gegenwärtiges und Rückblenden komplex verschachteln, umkreisen das tragische Schlüsselereignis. Stunde um Stunde werden Hintergründe offenbart, bis die Struktur des Textes die Protagonist*innen zueinander geführt hat und sich der Himmel über Jerusalem verdunkelt.
Aus dem Italien. v. Annette Kopetzki.
Fischer 2012.
Ela Aslan: Plötzlich war ich im Schatten
Elas Vater ist als Kurde in der Türkei so starken Repressionen ausgesetzt, dass er sich entschließt, mit seiner Familie nach Deutschland zu fliehen. Diese Flucht jedoch ist nur für vier Personen möglich; also folgt die 10-jährige Ela ihrer Familie erst ein Jahr später nach. Die Erzählung setzt ein, als sie ins Land „geschmuggelt“ wird: Durch Ich-Perspektive und Präsens entsteht ein ganz unmittelbares und dennoch weitgehend neutral gehaltenes Bild. Ohne je ins Kolportagenhafte zu verfallen, aber auch ohne große emotionale Gesten schildert Ela das doppelte Moment der Fremdheit. Sie kommt „neu“ in die Familie, und neu in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht. In ihrem Bildungshunger holt Ela Defizite jedoch rasch auf und übernimmt bald die Rolle der familiären Dolmetscherin. Als ihr Asylantrag abgelehnt wird, erfährt die Familie vom sogenannten Kirchenasyl: In Köln halten sich kurdische Familien unterstützt von einer Hilfsorganisation solange in einer Kirche auf, bis sie nach und nach in einzelnen Pfarreien untergebracht werden. Platzangst und Selektionsverfahren stehen am Beginn eines langen Weges. Der journalistischdokumentarische Charakter des Buches ermöglicht es, auch einen Außenblick auf ein jugendliches Leben einzunehmen. Ela hat Helfer*innen an ihrer Seite, sodass es letztlich doch gelingt, aus dem titelgebenden Schatten der Illegalität herauszutreten.
Arena 2012.
Frank Cottrell Boyce: Der unvergessene Mantel
Retrospektiv berichtet die inzwischen erwachsene Julie von einer Begegnung aus ihrer Volksschulzeit, als Dschingis und dessen kleiner Bruder Nergei neu in die Klasse kommen und sowohl Kinder als auch Lehrerin mit ihrem reichlich unkonventionellen Verhalten ebenso wie mit Geschichten vom fantastischen Leben in der Mongolei in Atem halten. Scheinbare Unglaubwürdigkeiten werden dabei mit Polaroidfotos aus der Welt geschafft – auch für die Leser*innen, denn der an das Erscheinungsbild eines Schulheftes angelehnte Text wird mit ebendiesen Fotos bebildert. Julie ist fasziniert von der fremden Welt. Erst als die erträumte Heimat sich als Patchwork aus Schulhofaufnahmen entpuppt, zeigt sich das wahre Schicksal einer Asylantenfamilie. Und eines Tages kommen die beiden Brüder nicht mehr in die Schule… Ein mit Sprachwitz und Situationskomik präsentierter Culture Clash, der am Symbol eines zotteligen Wintermatels unterschiedliche Erinnerungsebenen freilegt.
Aus dem Engl. v. Salah Naoura.
Carlsen 2012.
Hubert Gaisbauer / Renate Habinger: Schlaf jetzt kleines Kamel
Das kleine Kamel kann und will einfach nicht schlafen. Daraus entspinnt sich mit dem geduldigen großen Kamel ein facettenreicher Dialog, der die Welt philosophisch in ihrer ganzen Vielfalt auslotet. Renate Habinger taucht die Doppelseiten in ein tiefes, unregelmäßig getöntes Dunkelblau, das sie mit überarbeiteten Monotypien bespielt: Auf bedrucktem Untergrund werden einzelne Elemente collagiert und mit Buntstift eine Welt gezeichnet, die sich bewusst einem vordergründig-orientalischen Setting entzieht. Zu entdecken gibt es vielmehr ein In- und Miteinander verschiedener Zivilisationen: Da findet sich Eselskarren neben Handy und Moschee neben Kirche. Die letzte Seite verführt mit ihren über den Nachthimmel fliegenden Tieren aber leider nicht zum Schlafen, sondern zum Versinken in hinreißend schönen Bildwelten.
Wiener Dom-Verlag 2012.
John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter
Hazel ist 16 und dem Schilddrüsenkrebs knapp entkommen. Ein fiktives Medikament stundet ihr Leben und stilisiert sie zur vorläufig gesundeten Außenseiterfigur. Zurückgezogen lässt sich Hazel lediglich zu einer Selbsthilfegruppe drängen – eine skurrile Parodie ihrer selbst. Dort trifft sie den einbeinigen Gus. Beruhend auf der entwaffnenden Ehrlichkeit der beiden entsteht eine innige Freundschaft, immer an der Kippe zur Liebesgeschichte, der Hazel sich jedoch verweigert, um Gus zu schützen. Mit dem John Green eigenen schwarzen Humor wird die Geschichte einer Liebe mit Ablaufdatum erzählt, ohne je Krankheit als Form besonders tapferer Lebensbewältigung zu inszenieren.
Aus dem Engl. v. Sophie Zeitz.
Hanser 2012.
Heinz Janisch / Ingrid Godon: Rita
Bevor man Rita trifft, stellt der Erzähler andere Figuren und Elemente seiner Welt vor: Einen Matrosen, Luftschiffe, ein Labyrinth, einen Seiltänzer, eine Achterbahn. Allen gemeinsam ist das Motiv des Mutig-Seins: In die weite Welt auszuziehen, sich in höhere Gefilde aufzuschwingen, das Risiko sich zu verlaufen, abzustürzen oder schwindelig zu werden. Was das mit Rita, dem Mädchen mit der roten Badekappe, auf dem Sprungturm im öffentlichen Schwimmbad zu tun hat? So viel sei verraten: "Fische springen nicht von Türmen." Die aufs Wesentliche reduzierte Geschichte erzählt mit wenigen Worten, worin Ritas Tapferkeit letztendlich besteht. Unterstützt wird der zerbrechlich wirkende Erzählgestus von dementsprechenden Illustrationen: Collagenhaft und mit einfachen Strichen breitet sich die grün-türkisfarbene Welt, in der Ritas rote Badekappe hervor blitzt, aus.
Bloomsbury 2012.
Joke van Leeuwen: Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor
Todas Vater ist nicht mehr länger Feinbäcker. Ab jetzt ist er Soldat. Es ist Krieg in Todas Heimat und das Mädchen wird zu ihrer Mutter, an die sie sich nicht mehr erinnern kann, über die Grenze geschickt. Zuerst per organisierter Auswanderung, später ganz auf sich alleine gestellt begibt sie sich in ein fremdes Land, um dort auf eine noch fremdere Frau zu treffen. Joke van Leeuwen erzählt konsequent aus kindlich-naiver Sicht von den Etappen einer Flucht und der Unwissenheit des Mädchens ob der Krisensituation in ihrem Heimatland. Wobei niemals reale Nationen angesprochen werden – das Kriegsgeschehen bleibt abstrakt. Todas Entwurzelung wird gerade deshalb unmittelbar und durchaus beklemmend erfahrbar; durch das enthobene Szenario und die vielen zwischenmenschlichen Begegnungen auf ihrem Weg aber auch gelindert. Die konsequent verfolgte Wahrnehmung eines Kindes und die vielen Gedanken, die sich die junge Ich-Erzählerin macht, machen die Krisen einer Flucht und den Begriff der "Grenze" schon für jüngere Leser*innen verständlich. Auch die Illustrationen, die aus dem Text gegriffene Briefe, Notizen oder Buchseiten abbilden, verstärken die Authentizität.
Aus dem Niederländ. v. Hanni Ehlers.
Gerstenberg 2012.
Titus Müller: Der Kuss des Feindes
Im Jahr 800 n. Chr. ist Kappadokien von Arabern und Christen besiedelt, die beide Ansprüche auf das Gebiet erheben. Die Christen haben sich in die unterirdische Stadt Korama zurückgezogen, aus der die junge Savina im Schutz der Dunkelheit immer wieder ausbricht. Bei ihren Streifzügen trifft sie auf Arif, Sohn eines arabischen Hauptmanns. Aus dieser ersten Begegnung entwickelt sich eine offene, vertrauensvolle Liebe, deren Stärke sich in den gefahrvollen Ereignissen um die Belagerung der Stadt beweist. Der historische Roman bietet den Leser*innen konkrete Bezüge auf die Geschichte. Dem Autor gelingt es auf überzeugende Weise, nicht das Trennende, sondern vor allem die gemeinsamen Wurzeln von Christentum und Islam herauszustellen. Arif und Savina verkörpern die Überwindung von Vorurteilen und Feindschaft.
Fischer 2012.
Susann Opel-Götz: Außerirdisch ist woanders
Jona war schon immer von der Existenz Außerirdischer überzeugt. Endlich bestätigt wird dies, als Henri in sein Leben tritt. Die Freundschaft mit dem vermeintlichen (!) Alien und ihr gemeinsames Geheimnis seiner extraterrestrischen Identität stellen Jona aber bald auf eine harte Probe, in der er Solidarität beweisen muss. Mit eloquentem Wortwitz entsteht eine Geschichte übers Brückenbauen zwischen fremden Welten. Wobei es gar nicht so viel Unterschied macht, ob es sich dabei um eine galaktische oder doch um eine sehr irdische Form von (sozialer) Fremdheit handelt. Jonas Kopfkino, seine Kurzfass-Schwäche, Studien über menschliche Gewohnheiten und Kalenderweisheiten werden dabei zu wichtigen Stilmitteln.
Oetinger 2012.
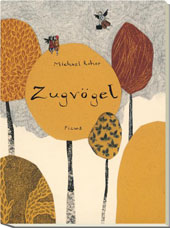


Michael Roher: Zugvögel
Michael Rohers Hang zu Leitfarben findet in diesem Bilderbuch inhaltliche Entsprechung: In gedeckten Herbstfarben collagiert und zeichnet er die Geschichte der Zugvögel. Doch was auf der Textebene als Vogel bezeichnet wird, ist im Bild als Mensch mit Schnabelmaske zu sehen. Die bunten Stoffe und fremden Muster tun ihr Übriges, markieren Andersartigkeit und Gemeinschaft zu gleichen Teilen. Luka freundet sich mit den seltsamen Vögeln an und will helfen, als es heißt: "Wir sind Zugvögel. Es ist uns nicht erlaubt zu bleiben." Gemeinsam mit Frau Lorenz findet er einen Unterschlupf für die Fremden – vorerst; und kann gemeinsam mit Paulinchen den ersten Schnee fallen sehen. Das poetische Bilderbuch ist auch als Allegorie auf Ute Bock und ihr einzigartiges Engagement lesbar und besticht sowohl durch seine künstlerische Gestaltung als auch durch seinen dringend notwendigen Aufruf zur Menschlichkeit.
Picus 2012.
Craig Silvey: Wer hat Angst vor Jasper Jones?
Australien 1965: Eines Nachts wird Charlie von Jasper Jones, dem Sündenbock des Dorfes, um Hilfe gebeten. Ihr Weg führt sie in den Busch, wo sie die Leiche eines Mädchens finden. Der vermeintliche Mord, von dem Jasper überzeugt ist, und der Versuch die Wahrheit herauszufinden, dienen als Ausgangspunkt, sind aber nur Teilaspekte des facettenreichen Romans. Erzählt wird von der Familiengeschichte Charlies, vom Erwachsenwerden, von der Dynamik einer Kleinstadt, vom Vietnamkrieg, aber auch von Kricketspielen und Dorffesten, die als freudiges Spektakel zelebriert werden. Gesellschaftskritische und entwicklungspsychologische Aspekte werden so anspruchsvoll miteinander verbunden.
Aus dem Engl. v. Bettina Münch.
Rowohlt 2012.
Jordan Sonnenblick: Buddha-Boy
Neue Schule, neue Persönlichkeit – so die Strategie von San Lee. Durch Zufall und seine asiatische Herkunft wird er von seinen Mitschüler*innen zum Zen-Buddhisten auserkoren. Eine Rolle, die er gerne annimmt, vor allem als er bemerkt, dass dies bei einem Mädchen auf besonderes Interesse stößt. Das Lügengeflecht, in das er sich dabei verstrickt, ist wie so oft zum Reißen verurteilt – doch bevor dies passiert, erfahren Lesende gemeinsam mit dem Protagonisten eine selbstrecherchierte Einführung in buddhistische Lehren. Trotz konkreter Wissensvermittlung wird die Religionsaneignung Sans durch bedeutungsschwangere Weisheiten oder ironisierende Kommentare köstlich persifliert. Der satirische Ton wird nie gebrochen und bereichert die Lektüre dieses wahrlich „weisen“ Buches.
Aus dem Engl. v. Gerda Bean.
Carlsen 2012.


Shaun Tan: Der rote Baum
Ein fallendes Blatt irritiert ein erwachendes Kind, in dessen Leben ein Tag "ohne Aussicht auf etwas Schönes" beginnt. Plötzlich überflutet ein ganzes Blättermeer das Zimmer und das Kind flüchtet, um mit jeder neuen Doppelseite zu erfahren, das solche Tage "nur noch schlimmer" werden können. Und doch wird das von Traurigkeit geprägte Szenario gebrochen. Auf jeder Doppelseite, auf der das depressive Empfinden des Mädchens erneut in gewaltigen, verschachtelten und oft endzeitlich anmutenden Sujets verbildlicht wird, findet sich auch jenes rote Blatt, aus dem zuletzt der titelgebende Baum des Glücks erwächst. Hoffnung und Leid werden damit als integraler Bestandteil auch eines kindlichen Lebens thematisiert. "Dunkelheit senkt sich herab." Die emotionale Irritation jedoch wird aufgefangen in der Schönheit und Eindringlichkeit der bildlichen Komposition, sodass ein einzigartiges Stimmungsbild entsteht.
Aus dem Engl. v. Eike Schönfeld.
Aladin 2013.
Germano Zullo / Albertine: Wie die Vögel
Ein Mann fährt mit seinem LKW in die Einöde, um dort Vögel freizulassen. Sehnsüchtig blickt er ihnen nach, während sie von der Bildfläche verschwinden. Alle fliegen in die Freiheit, nur ein Vogel bleibt zurück und wird nun von dem Mann animiert, sich den anderen anzuschließen. Schlussendlich fliegt der Vogel, aber nicht ohne dass der Mann mit ihm in die Lüfte steigt. Die Geschichte wird ohne Text – lediglich einleitende Worte werden vorangestellt – und durch reduzierte Illustrationen erzählt. Diese Simplizität hat eine bestechende Wirkung, vermittelt bedeutungsvoll große Themen und ermöglicht gleichzeitig einen breiten Interpretationsspielraum, so dass die Assoziationen zu diesem Bilderbuch in alle Richtungen wandern können. Ein tiefgründiges Leseerlebnis, dass für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen bereichernd ist.
Carlsen 2012.