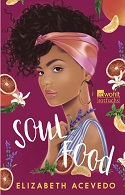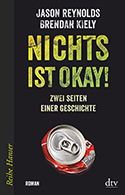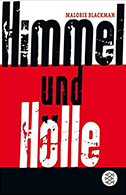Thema: Black Empowerment

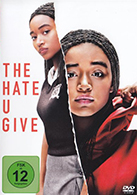
Angie Thomas: The Hate U Give
Leute wie wir werden in solchen Situationen zu Hashtags, aber Gerechtigkeit kriegen sie kaum einmal. Die 16-jährige Ich-Erzählerin Starr lebt in zwei Welten: Sie wächst in einem Schwarzen Viertel auf, besucht aber eine teure, überwiegend weiße Privatschule. Diesen Spagat weiß sie diplomatisch zu bewältigen – im Mikrokosmos der Schule vermeidet sie alles, was sie als „black angry girl“ ausweisen könnte. Bis ein folgenschwerer Abend ihre Welt ins Wanken bringt: Nach einer Party gerät sie mit einem Freund in eine Fahrzeugkontrolle. Er macht eine unüberlegte Bemerkung, eine zu schnelle Bewegung – und wird vom Streifenpolizisten erschossen. Die in Jackson, Mississippi, geborene Autorin Angie Thomas hat in ihrem Debüt die Morde an Alton Sterling und Philando Castile 2016 durch die Polizei als Folie genommen, um beispielhaft davon zu erzählen, wie struktureller Rassismus in den USA alltäglich ist und welche Folgen Morde wie diese für die Hinterbliebenen haben. Die titelgebende Umdeutung des Slangwortes THUG für Verbrecher*in wird dabei zum Leitmotiv: Rassismus, der von der Mehrheitsbevölkerung ausgeht, wird wieder auf diese zurückfallen. Zentrales Motiv wird dabei die Frage, was Starr als einzelne tun kann, angebunden an die Topographie des Textes.
Aus d. Amerikanischen v. Henriette Zeltner.
cbt 2017.
508 S.
The Hate U Give. Film v. George Tillman Jr.
Seine zentrale Stellung im internationalen Diskurs hat Angie Thomas' Debüroman „The Hate U Give“, der nicht nur in der USA zu einer der bedeutendsten Manifestationen der #BlacklLivesMatter-Bewegung in der Populärkultur wurde, mit seiner gleichnamigen Verfilmung von George Tillman, Jr. gefestigt. Fast noch expliziter als die Buchvorlage schreibt sich die filmische Adaption in aktuelle politische Diskurse in den Vereinigten Staaten ein; gerade in den Demonstrationsszenen wirken die Bilder fast schon dokumentarisch. Neben den großartigen Performances von Russell Hornsby (als Maverick Carter) und Common (als Starrs Onkel Carlos) überzeugt vor allem Amandla Stenberg in der Hauptrolle der 16-jährigen Starr, auf deren Innenperspektive auch die filmische Erzählung konsequent fokussiert. Ihre Voice-overs begleiten uns durch ihren persönlichen Blickwinkel, ihr Gesicht und ihre Emotionen füllen die häufigen Close-ups. Die großteils differenzierte Figurenzeichnung lässt Differenzen zu und denkt Tupac Shakurs Umdeutung des Slangwortes Thug (für Verbrecher*in) als Akronym selbstkritisch weiter. In einer bedeutungsgeladenen Szene, in der Starrs kleiner Bruder Sekani eine Waffe auf den Ganglord King richtet, hört man die Stimme von Starr aus dem Off auch die Rolle ihrer eigenen Black Community infragestellen: It’s not the hate you give. It’s the hate we give. But we can break the cycle.
USA 2019.128 min.


Angie Thomas: On the Come up
In ihrem zweiten Jugendroman, der chronologisch an „The Hate U Give“ anschließt, erzählt Thomas aus der Ich-Perspektive der 16-jährigen Brianna „Bri“ Jackson, die in die Fußstapfen ihres von Gangmitgliedern ermordeten Vaters, der sich in Garden Heights als Underground-Legende einen Namen gemacht hatte, steigen und als Rapperin Erfolg haben möchte. Für Bri geht es vor allem um Fragen der künstlerischen Inszenierung in einer Gesellschaft, die lieber auf Stereotype zurückgreift, als auf die komplexen Realitäten dahinter zu blicken: Folgt Bri dem provokativen Gangsta-Rap und macht als scheinbar gewaltbereite gottverdammte Ganovin? The picture you painted, I frame it. Oder findet sie eine authentische Stimme, mit der sie festschreibt: I’m not for sale. Gerahmt von zwei Auftritten im Mekka des Rap wird der musikalische Battle zum Sinnbild eines inneren Kampfes um Authentizität und Selbstbestimmtheit. Dabei verhandelt der Roman nicht nur vielschichtige Fragen der (Ohn-/Macht über) Selbst- und Fremdrepräsentation, sondern auch die vielschichtigen Spannungsverhältnisse und Abhängigkeiten von Armut, Gewalt, Kriminalität und Diskriminierung.
cbt 2019.
502 S.
Angie Thomas: Concrete Rose
Garden Heights, 1998: Wie alle Burschen in seiner Nachbarschaft ist Maverick „Mav“ Carter Mitglied in einer Gang. Als er Vater wird, scheint die Zeit für seinen Ausstieg gekommen. Dann aber wird sein bester Freund ermordet und Mav weiß ziemlich sicher, wer dahintersteckt … Den erwachsenen Maverick kennen wir als liebevollen Vater der 16-jährigen Starr aus „The Hate U Give“. In Angie Thomas’ drittem Roman treffen wir ihn nun als Jugendlichen, der kurz vor seinem Highschoolabschluss mit seiner plötzlichen Vaterschaft konfrontiert ist. Neben Windelnwechseln und Fläschchengeben jobbt Mav nach der Schule in Mr. Whyatts Grocery-Geschäft, um für seine neue Familie zu sorgen. Für viel reicht das hart verdiente Geld nicht und der Druck für Mav „seinen Mann zu stehen“ steigt. Entlang von Zitaten aus einem Song von Tupac Shakur erzählt Thomas von Mavericks Suche nach einem Selbstverständnis und Selbstwertgefühl jenseits dessen „was die Welt von Schwarzen Kids erwartet“. Seine vielseitige, unterhaltsame Erzählstimme gibt sich mal frech und aufsässig, mal einfühlsam und verletzlich – und kämpft darum, den Mut aufzubringen, um sich jenseits destruktiver Gendernormen zu positionieren.
Aus d. Amerikanischen v. Henriette Zeltner.
cbt 2021.
416 S.
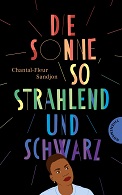
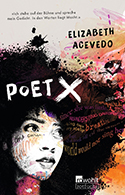

Chantal-Fleur Sandjon: Die Sonne so strahlend und Schwarz
Nova Nyanyoh Breitenbauer ist 17 Jahre alt, Rollkunstläuferin – zumindest war sie das, bis ein zertrümmerter Arm sie zum Pausieren zwang – und gerade mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus dem Frauenhaus in eine neue Wohnung gezogen. Gemeinsam mit ihrer Familie versucht sie neu anzufangen, wieder aufzustehen, nach den Gewalttätigkeiten ihres Stiefvaters. Ihre Resilienz und Widerständigkeit schöpft Nova nicht nur aus ihrem kosmologisch inspirierten Namen und den damit zusammenhängenden Bedeutungsdimensionen, sondern auch aus der Beziehung zu ihren Freund*innen. Das Navigieren innerhalb etablierter Gesellschaftsnormen, Geschlechterrollen und Begehrensformen verhandelt die afrodeutsche Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Chantal-Fleur Sandjon in ihrem kunstvollen Versroman dabei ebenso differenziert wie Fragen der Zugehörigkeit als Schwarze Jugendliche in Deutschland. Zwischen (un)geglättetem Afrohaar und erster großer Liebe entwirft sie so eine ausdrucksstarke intersektionale jugendliterarische Poetik, in der sich Politisches und Privates gegenseitig durchdringen – während Buchstaben und Verszeilen rhythmisch-akrobatisch durch die Buchseiten tanzen.
Thienemann 2022.
384 S.
Elizabeth Acevedo: Poet X
In „Poet X“ erzählt die junge afrodominikanische Autorin aus den USA von einem hispanischen Mädchen, dessen Familie aus der Dominikanischen Republik nach New York migriert ist: Weder mit der gottesfürchtigen Mutter noch mit dem verschwiegenen Vater kann sich Xiomara identifizieren. Sie ist kein braves Mädchen, das still in Blumenkleidchen lächelt, sondern Babyspeck, der sich in D-Körbchen und geschwungene Hüften verwuchs, dunkel und kurvig und wütend. Wütend über die männlichen wie weiblichen, erwachsenen wie gleichaltrigen, gesellschaftlichen wie familiären Zugriffe auf ihren weiblichen Körper. Wütend über die alltäglichen sexualisierten Mikroaggressionen und normalisierten Übergriffigkeiten einer Gesellschaft, die Xiomara gelehrt hat, ihren Körper als „Unannehmlichkeit“ zu begreifen und das „Problem“ bei sich selbst anstatt den Anzüglichkeiten anderer zu suchen. Ihr körperliches Zuviel versucht sie hinter zu großen Klamotten zu verstecken. Ihre ungestüme, aufbegehrende Stimme weiß sie zunächst jedoch nur in jenen Verszeilen zu äußern, die sie in ihrem Notizheft niederschreibt – und die auch das vorliegende Buch speisen. Nur schrittweise wagt sie es, aus dieser Selbstzensur auszubrechen und ihre Gedanken und Empfindungen laut aussprechen: zuerst alleine vor dem Spiegel, dann auch gegenüber ihrem Bruder und ihrer besten Freundin, und schließlich in einem Spoken Word Poetry Club.
Aus d. Amerikanischen v. Leticia Wahl.Rowohlt Rotfuchs 2019.
352 S.
Jason Reynolds: Long Way Down
In Form eines Versromans erzählt der afroamerikanische Autor von einem Alltag, in dem drei Regeln das Leben bestimmen: Nicht weinen. Niemanden verpfeifen. Rache nehmen. Nachdem sein Bruder von Gangmitgliedern auf der Straße erschossen wurde, ist es an Will, eine Entscheidung zu treffen. Genau eine Minute hat er dafür Zeit – so lange, wie die Fahrt mit dem Fahrstuhl dauert. Der zeitlich radikal verdichtete Text, den Jason Reynolds in Zeilen-, Wort- und Buchstabeneinheiten rhythmisiert, experimentiert dabei nicht nur mit Klang, Tempo, Form und Layout, sondern auch mit der Wahrnehmung von (Erzählzeit und erzählter) Zeit. Im Angesicht der traumatischen Erfahrung der Ermordung seines Bruders und seiner eigenen nahenden todbringenden Tat sieht sich Will im beengten Raum des Fahrstuhls auf sich selbst und seine sich beinahe überschlagenden Gedanken zurückgeworfen. Konsequent bleibt Jason Reynolds Wills Innenperspektive verpflichtet und zeichnet überzeugend das subjektive Bewusstsein eines von sozialen Institutionen im Stich gelassenen Opfers von Waffengewalt nach und fragt nach den Möglichkeiten, diese Spirale zu durchbrechen.
Aus d. Amerikanischen v. Petra Bös.dtv 2019.
320 S.

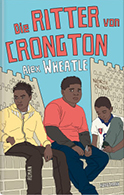
Alex Wheatle: Liccle Bit. Der Kleine aus Crongton.
Lemar ist 14 Jahre alt, unscheinbar und kunstbegabt, bringt ein bisschen zu viel Pfund auf die Waage und ein bisschen zu wenig Zentimeter in die Höhe, weswegen er von allen nur „Liccle Bit“ genannt wird. Er lebt in der fiktiven Stadt Crongton, die Alex Wheatle in ein britisches Umfeld einbettet, ihr durch zahlreiche US-amerikanische, internationale Anleihen aber zugleich einen kosmopolitischen Charakter einschreibt. In seinem jugendliterarischen Debüt entwirft der britische Autor mit jamaikanischer Abstammung jene sowohl in räumlich-sozialer als auch in sprachlicher Hinsicht eindrückliche Erzählwelt, in der auch die folgenden Bände seiner Crongton-Trilogie verortet sind. In einer Stadt, in der die Majorität der Bevölkerung Schwarz ist – was im Buch jedoch kaum angesprochen und dadurch normalisiert wird – und die in zwei Teile geteilt ist: Seit Generationen sind die North Crongs und die South Crongs in brutale Bandenkriege verstrickt, die auch das Leben von Lemars Familie bestimmen. Dieser lebt in South Crongton gemeinsam mit drei weiteren Generationen (Großmutter, Mutter, Schwester, Neffe) in einer viel zu kleinen Wohnung, in der es an männlichen Vorbildern mangelt. Besonders bemerkenswert ist auch Wheatles erfundene Jugendslangsprache, die die Schnelllebigkeit und Vielseitigkeit von Alltagssprache gekonnt einfängt.Aus d. Englischen v. Conny Lösch.
Kunstmann 2018.
256 S.
Alex Wheatle: Die Ritter von Crongton.
Der zweite Teil der Crongton-Serie richtet sich rund um das Kerngespann des ersten aus, fokussiert jedoch auf die Ich-Perspektive von Liccle Bits bestem Freund McKay und dessen Familie, die mit dem kürzlichen Tod der Mutter, der Spielsucht des Vaters und den Bandenbeziehungen des Bruders zu kämpfen hat. Sechs Monate nach den Ereignissen zwischen Liccle Bit und Manjaro befindet sich Crongton in einem Ausnahmezustand: Nach Manjaros Verschwinden ist der öffentliche Raum noch unsicherer als zuvor geworden. Immer weniger Eltern lassen ihre Kinder aufgrund der vermehrten Bandenkonflikte und Polizeikontrollen auf die Straße. Da kommt es besonders ungünstig, dass die Freunde ausgerechnet jetzt Venetia zur Hilfe eilen müssen, um deren Handy (mit kompromittierenden Fotos) von ihrem Exfreund am anderen Ende der Stadt zurückzuholen. Gleich einer mittelalterlichen Quest machen sich die jugendlichen Gefährten auf in ihre Heldenreise durch den territorialisierten Stadtraum, dessen räumliche und soziale Mobilitätseinschränkungen zunehmend kritisch hinterfragt werden. Auch in diesem Band überzeugt Wheatles einmalige, schwungvolle Jugend-Kunstsprache mit ihren flotten Dialogen, eigenwilligen Sprachspielen und innovativen Sprachbildern, mithilfe derer er auf jugendliche Lebenswelten blickt und die englische Sprache aus sozial-ethnischer Perspektive neu erfindet.
Kunstmann 2018.
256 S.
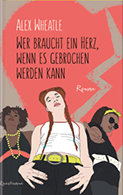
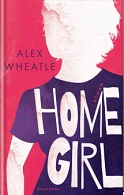
Alex Wheatle: Wer braucht ein Herz, wenn es gebrochen werden kann
Nicht nur mit der linear fortschreitenden Chronologie, sondern auch mit den bisherigen männlich-Schwarzen Erzählperspektiven bricht das dritte Buch der Crongton-Serie, in dem die weiße 15-jährige Maureen „Mo“ Baker, beste Freundin von Naomi Brisset und Liccle Bits großer Schwester Elaine Jackson – hier schließt sich der Kreis zum ersten Teil – vier bzw. fünf Jahre vor den Vorkommnissen der ersten beiden Bücher ihre Stimme erhebt. Es sind starke, selbstbewusste, aber zugleich gebrochene weibliche Identitätsentwürfe, die mit den drei jugendlichen Protagonistinnen ins Zentrum gerückt und durch das Versagen sozialer Institutionen und erwachsener Bezugspersonen in prekäre Situationen gebracht werden. Deren zögerliches Abwarten im Angesicht des zunehmend gewalttätigen Liebhabers von Mos alleinerziehender, völlig überforderter Mutter führt schließlich zu einer physischen Eskalation, die weitreichende Folgen trägt. Auf differenzierte Weise zeigt Wheatle, wie strukturelle Benachteiligung und Perspektivenlosigkeit sowie daraus resultierende Gewalterfahrungen eine gefährliche Kombination aus Wut, Aggression und Frustration aufbauen, die im scheiternden Gesellschaftssystem ihren (unweigerlichen?) Fortlauf nimmt. Beeindruckend ist Mos ungebrochen selbstbestimmtes Auftreten, das in dem komplexen, ambivalenten Gefüge weiblicher Opfer-, Täter- und Helferrollen stets auf ihre Rechte als Tochter, Frau, Bürgerin, und Mensch beharrt und sich – im Gegensatz zu den meisten erwachsenen Figuren – ihrer Verantwortung stellt.
Kunstmann 2019.
280 S.
Alex Wheatle: Home Girl
Ähnlich wie Teil 3 der Crongton-Romane richtet sich auch der vierte Band an ein älteres Publikum: Naomi kennen wir aus dem vorangegangenen Buch als beste Freundin von Mo und Elaine. In „Home Girl“ treffen wir sie nun, ein Jahr bevor sie nach Crongton kommt: Sie ist 14, widersetzt sich jeglicher Bevormundung und schreckt vor kaum einem Kraftausdruck oder davor, die Wahrheit zu ihren eigenen Zwecken zurechtzubiegen, zurück. Viel zu früh musste sie nach dem Selbstmord ihrer Mutter lernen, auf sich selbst aufzupassen, und sich um ihren alkoholkranken Vater zu kümmern. Als endlich das Sozialamt eingreift, wird Naomi von einer Pflegefamilie zur nächsten verfrachtet. Nirgends kann/will sie sich einfinden, niemandem vertraut sie. Das ändert sich erst, als sie kurzfristig bei den Goldings untergebracht wird. Das Problem: Naomis neue Pflegefamilie ist Schwarz, Naomi weiß – eine Konstellation, die nicht nur im Fürsorgesystem ungern gesehen wird, sondern auch andernorts auf Irritationen stößt. In einem einzigartigen Balanceakt zwischen ernst(zunehmend)en Themen und innovativem Sprachwitz manövriert Wheatle seine Figuren durch die komplexen Verflechtungen von verfehlter politischer Korrektheit und tiefsitzenden Ressentiments, von fehlgeleiteten Freundschaften und neuen Zugehörigkeiten.
Aus d. Englischen v. Conny Lösch.
Kunstmann 2020.
280 S.
Elizabeth Acevedo: Soul Food
Dass die gefeierte Poetry-Slammerin Elizabeth Acevedo mit Sprache umgehen kann, hat sie bereits in ihrem Versroman „Poet X“ gezeigt. In „Soul Food“ beweist sie nun, dass sie auch die ungebundene Form der Prosa meisterhaft beherrscht: Die 17-jährige Emoni steht kurz vor ihrem Highschoolabschluss – deren kleine Tochter Emma vor dem ersten Kindergartenbesuch. Trotz der Unterstützung ihrer ’Buela (kurz für „abuela“, span. Großmutter), bei der die beiden leben, und Emonis besten Freundin Angelica ist der Alltag der afro-puerto-ricanischen, in Philadelphia aufgewachsenen Protagonistin selten unbeschwert. Stets ist sie mit den Vorurteilen und Erwartungen anderer konfrontiert – ihre Zugehörigkeiten muss sie sich erst erkämpfen. Ihrer Herkunftssprache kaum mächtig, identifiziert sich Emoni mit ihren lateinamerikanischen Wurzeln vor allem in Form von jenen Gerichten, die sie täglich auf den Tisch zaubert. Denn eines wusste sie schon als kleines Kind: als Köchin zu arbeiten, das ist ihr großer Traum. Eindringlich und atmosphärisch zeichnet Acevedo ein vielschichtiges Bild der adoleszenten und kulturellen Identitätssuche einer jungen Frau of color, deren Entschlossenheit inspiriert.
Aus d. Amerikanischen v. Anne Brauner.
Rowohlt 2021.
400 S.
Jason Reynolds: Brüder
Die Sommerferien sollen die zwei afroamerikanischen Brüder Genie (11) und Ernie (13) am Hof der Großeltern im ruralen Virginia verbringen, während die Eltern auf Jamaika ihrer Ehe eine letzte Chance geben wollen. Eine Herausforderung für die beiden Großstadtjungs aus Brooklyn – nicht einmal Internet gibt es dort, dafür aber jede Menge zu tun: Zwischen Hofkehren und Erbsenpflücken lernen sie nicht nur das Leben im ländlichen Süden der USA besser kennen, sondern auch ihren blinden, starrsinnigen Opa und ihre tatkräftige, strenge Oma, die sie aufgrund eines tiefgehenden Zerwürfnisses zwischen Vater und Großvater bisher kaum gesehen hatten. Sie entdecken ein geheimnisvolles Haus im Wald, besuchen das resolute Nachbarsmädchen Tess und füttern die Vögel in Opas besonderem, ganz persönlichem Rückzugsort. Erzählt wird die atmosphärische Familiengeschichte aus der Ich-Perspektive des wissbegierigen Genie, der eine nummerierte Liste mit (bereits über 400!) Fragen führt, die er nachgoogeln möchte – wenn er doch nur endlich wieder Zugang zum Internet bekäme!
Letztlich wird deutlich, dass Mut nicht immer Tapferkeit, sondern vor allem Ehrlichkeit und das Eingestehen von Fehlern bedeutet – selbst, oder gerade dann, wenn diese bereits weit in der Vergangenheit zurückliegen.
Aus d. Amerikanischen v. Klaus Fritz.
dtv
2020.
384 S.
Jason Reynolds / Brendan Kiely: Nichts ist okay! Zwei Seiten einer Geschichte
Die US-amerikanischen Autoren Jason Reynolds und Brendan Kiely lassen zwei jugendliche Ich-Erzähler alternierend jene Geschichte über rassistisch motivierte Polizeigewalt erzählen, die ihre gesamte Schule beschäftigt: Rashad, Schwarz, 16 Jahre, wird von Officer Guzzo des Ladendiebstahls verdächtigt, aus dem Supermarkt gezerrt und krankenhausreif geprügelt – weil der Polizist gesehen haben will, dass er stehlen wollte. Quinn, Weiß, ebenfalls 16 und der beste Freund von Guzzos kleinem Bruder, sieht die brutale Festnahme und kann sie nicht vergessen. Was von Rashads Familie und auch bei Angie Thomas in „The Hate U Give“ sowie „On the Come Up“ ganz explizit angesprochen wird, wird in Quinns Erzählung zunächst nur vorsichtig formuliert. Selbst nachdem die US-amerikanische #BlackLivesMatter-Bewegung bereits internationale Bekanntheit erlangt hatte, dauert es in der Erzählperspektive des Weißen Junges lange, bis zum ersten Mal das Wort „Rassismus“ fällt. Damit kritisieren Reynolds und Kiely nicht nur die fehlende kritische Auseinandersetzung mit rassistischer Polizeigewalt unter der Weißen Mehrheitsbevölkerung, sondern literarisieren auch die getrennten Welten, in denen die beiden Jugendlichen leben. Das Verhalten des Polizisten und Rashads Verletzungen spalten Sportmannschaften, Freunde und Familien. Erst nach und nach begreift Quinn die Konsequenzen dessen, was er gesehen hat – und wozu er nicht länger schweigen will. Entschlossen zeigt der Text, dass auch bzw. gerade er als privilegierter Weißer gemeinsam mit den Betroffenen seiner Stimme Gehör verschaffen kann und muss.
Aus d. Amerikanischen v. Klaus Fritz u. Anja Hansen-Schmidt.
dtv 2016.
311 S.
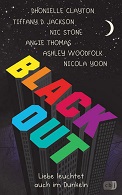

Dhonielle Clayton / Tiffany D. Jackson / Nic Stone / Angie Thomas / Asley Woodfolk / Nicola Yoon: Blackout. Liebe leuchtet auch im Dunkeln
New York City, an einem unerträglich heißen Sommerabend: Overload. Blackout. In der Stadt, die niemals schläft, erlöschen plötzlich die Lichter. Straßen und Gebäude liegen im Dunkeln, U-Bahnen stehen still, Ampeln fallen aus. Dennoch bahnen sich die zwölf Protagonist*innen ihre Wege durch das urbane Zentrum, um zu Twigs Block-Party in Brooklyn zu gelangen. Diese wird zum Dreh- und Angelpunkt der Erzählung, an der die Figuren am Ende — manche unbekannter Weise — zusammenkommen werden. Und an dem der große Showdown stattfinden wird. Entstanden ist dieser Text durch die Zusammenarbeit sechs junger wortgewandter afroamerikanischer Autorinnen: In sechs verschiedenen, ineinander verschränkten Erzählungen folgen sie unterschiedlichen Figuren- und Beziehungskonstellationen, die in ihrer Diversität aktuelle jugendliche Lebenswelten widerspiegeln. In ihrem kollektiv konzipierten und erzählten Text verquicken sie nicht nur auf innovative Weise die Genres Roman und Anthologie, sondern brechen auch gekonnt mit viel zu lange tradierten Klischees und Konventionen der Gattung Liebes(jugend)roman. Dabei richten sie sich an alle Leser*innen, die eine (bzw. sechs) mitreißende Liebesgeschichte(n) abseits der gängigen Narrative lesen möchten.
Aus d. Amerikanischen v. Anja Galić u. Katarina Ganslandt.
cbj 2021.
304 S.
Jason Reynolds: Asphalthelden
Nach seinem Versroman „Long Way Down“ entführt der afroamerikanische Autor wieder in ein besonderes Raum-Zeit-Gefüge – und wieder hat er eine besondere Form dafür gefunden: In zehn Kurzgeschichten erzählt er aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln vom Nachhauseweg verschiedener Schüler*innen aus der 6. Klasse. Zehn ineinander verwobene Erzählungen widmet er jenem kindlichen-autonomen Freiraum, der sich zwischen den beiden geschützten, von Erwachsenen betreuten Räumen der Schule und dem Zuhause auftut. Dabei eröffnet Reynolds eine Vielfalt unterschiedlicher (Lebens-)Welten und bricht wiederholt mit aufgebauten Erwartungshaltungen. Es sind keine linearen Wege, die ohne Hindernisse, unerwarteten Begegnungen und Umwegen bewältigt werden können, die die Protagonist*innen hier zurücklegen. In kurzen, eindringlichen Ausschnitten geben sie dabei Einblicke in ihren Alltag und jene sozialen Gefüge, in die ihre Biografien eingebettet sind. Oft bricht Reynolds mit zunächst aufgebauten Erwartungshaltungen und verschränkt dabei mehrere (Lebens-)Welten auf kunstvolle Weise, wenn er atmosphärisch von alltäglichen Begegnungen, von kleinen und großen Fragen, die die Protagonisten bewegen und beschäftigen, erzählt.
Aus d. Amerikanischen v. Anja Hansen-Schmidt.
dtv 2021.
192 S.
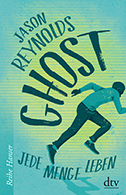
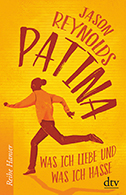
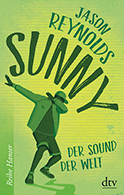
Jason Reynolds: Ghost
Mit seiner Defenders-Tetralogie legt Jason Reynolds eine chronologisch angelegte Romanserie vor, deren Bände jeweils einer anderen Erzählperspektive folgen. Die „Defenders“ sind ein jugendliches Laufteam in einer Kleinstadt im Süden der USA. Ghost, Patina, Sunny und Lu sind alle neu im Team und müssen erst ihren Platz finden – in der Mannschaft, im Freundeskreis und in ihrem jeweiligen Familiengefüge. Rhythmisiert durch die wiederholten Lauftrainings thematisieren ihre wortgewandten Erzählstimmen aber nicht nur die Suche nach Freundschaft, Zugehörigkeit und Zusammenhalt, sondern auch das Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen sowie den Umgang mit traumatischen Erfahrungen, Krankheit und Diskriminierung.
In Ghosts Erzählung, dem ersten Teil der Serie, verdichtet sich das Laufen und Weglaufen zu einem zentralen Motiv: in das Weglaufen vor seinem gewalttätigen Vater, das Weglaufen vor seiner Vergangenheit und seinen Erinnerungen und das Weglaufen vor Verantwortung. Aus kindlicher Verzweiflung begeht der aufbrausende Ghost, der eigentlich Castle Crenshaw heißt, wie sein Vater ständig auf Sonnenkernen herumkaut und seine Identität entlang von Weltrekorden festschreibt. Trotz der ernsthaften Themen büßt Ghost jedoch nie seinen spritzige Erzählton ein.
dtv 2018.
193 S.
Jason Reynolds: Patina
Patinas alleinerziehende Mutter, alias "Ma", hat aufgrund ihrer schweren Diabeteserkrankung beide Beine verloren, weshalb Patina und ihre kleine Schwester Maddy nun bei ihrem Onkel und ihrer Tante, die sie liebevoll "Momly" nennen, leben. Feinfühlig erzählt Jason Reynolds im zweiten Teil seiner Defenders-Tetralogie, wie sich die beiden Kinder in ihr neues Zuhause einfinden und wie sich dabei die Beziehung der Schwestern verändert. Denn Patina fühlt sich nicht nur für den Haarstyle von Maddy verantwortlich – ihre Weiße Momly hat natürlich keine Ahnung, wie man einen Afro richtig frisiert. Sie will gerade jetzt ihrer Ma zeigen, wie schnell sie laufen kann. Gerade diese Alltäglichkeiten, die vielschichtigen Einblicke in das Innenleben der Protagonistin und die differenziert gezeichneten Familienstrukturen zeichnen den Roman aus. Auf der neuen Elite-Schule, auf die sie von Tante und Onkel geschickt wird, fühlt sie sich fehl am Platz und vermisst ihre Freunde. Und auch in der Laufmannschaft muss sich Patina erst in das keineswegs konfliktfreie Staffelteam einfügen, mit ihren Teamkolleginnen in Einklang kommen und über so manche Schatten springen. Dass Patina trotz aller Schwierigkeiten ihren Humor und ihre erzählerische Leichtigkeit behält, ist nur einer der bemerkenswerten Züge ihrer starken, selbstbestimmten weiblichen Erzählstimme.
Aus d. Englischen v. Anja Hansen-Schmidt.dtv 2018.
237 S.
Jason Reynolds: Sunny
In Tagebuchform tritt Sunny, dessen Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, mit einem fiktiv-fiktionalen Du in Dialog, um sich jenes personifizierte Gegenüber zu imaginieren, das in seiner Familie ein klaffendes Loch hinterlassen hat. Obwohl Sunny der beste 1600-Meter-Läufer im Team der „Defenders“ ist, will er eigentlich gar nicht so schnell laufen wie seine Mutter. In seiner Selbstbefragung durch das Tagebuch, verarbeitet er seine inneren Konflikte und Schuldgefühle. Dabei wird die Sinnlichkeit des Hörens zum zentralen Sound-, Bild- und Strukturmoment des dieserart fragmentierten und rhythmisierten Textes. Damit fällt der dritte Defenders-Teil auch aus dem formalen Rahmen der Serie und fügt dem Erzählgefüge eine ausgeprägte, individuelle Erzählerstimme hinzu. Diese spannt den Bogen von jenem Tag weg, an dem die Familie den Geburtstag der Mutter feiert: also von jenem Wettkampftag, mit dem Jason Reynolds Patinas zweiten Teil ausklingen ließ – bis hin zu jenem Tag, an dem die Mutter gestorben und Sunny geboren worden ist: jenem erneuten Wettkampf, an dem Sunny das erste Mal im Diskuswerfen antritt.
Aus d. Englischen v. Anja Hansen-Schmidt.dtv 2019.
19 S.
Tomi Ayedemi: Children of Blood and Bone
Als Kind musste Zélie der Ermordung ihrer Mutter beiwohnen, als der König von Orïsha alle erwachsenen Majis – jene durch ihre weißen krausen Haare markierten Menschen, die über Magie verfügen – töten ließ. Als „Maden“ beschimpft und ihren magischen Kräften sowie ihrer Sprache (Yoruba) beraubt, werden ihre übrigen Nachkommen in der neuen Gesellschaft marginalisiert und diskriminiert. Zélies Kräfte werden jedoch reaktiviert, als sie auf die aus dem Schloss geflohene Königstochter Amari trifft, die einen jener magischen Gegenstände bei sich hat, die in einem geheimen Ritual die Mächte der Majis wieder erwecken können. Gemeinsam mit Amari und ihrem Bruder Tzain macht sich Zélie auf, um die fehlenden Artefakte zu suchen. Amaris Bruder Inan, der Heerführer des Königs, ist ihnen jedoch dicht auf den Fersen … In den USA wurde Adeyemis Debütroman mit Euphorie aufgenommen. Die Autorin entwirft darin ein phantastisches Setting, das deutliche Anleihen an nigerianische Topographie, Kultur, Mythologie und Folklore nimmt und sich so der afrikanischen Herkunftskultur seiner Verfasserin und vieler seiner Leser*innen ermächtigt – anstatt wie bisher weiße Fantasy-Narrative weiterzuschreiben.
Aus d. Amerikanischen v. Andrea Fischer.Fischer FJB 2018.
622 S.
Malorie Blackman: Himmel und Hölle
Callum und Sephy sind ineinander verliebt, stehen aber an zwei unterschiedlichen Polen ihrer Gesellschaft. Diese ist nach einer strengen Rassentrennung geregelt, die in der deutschsprachigen Übersetzung auf sprechende Weise gemäß der Hautfarbe zwischen „Alphas“ und „Zeros“ unterscheidet. Callum ist Weiß, Sephy ist Schwarz, und beide erzählen abwechselnd aus ihrer subjektiven, nicht selten verblendeten Ich-Perspektive. Dank eines besonderen Erzähltricks wird aber erst nach ca. 50 Seiten klar, dass die uns nicht unbekannte Zweiklassengesellschaft hier auf den Kopf gestellt wird. Als ehemalige Sklaven haben die hellhäutigen Zeros nur wenig Perspektiven, müssen sich ihre Rechte hart erkämpfen und werden von der dunkelhäutigen Mehrheitsgesellschaft mit rassistischen sprachlichen und strukturellen Mitteln diskriminiert. In ihrer Jugendbuchserie führt die britische Autorin das Romeo-und-Julia-Motiv in eine dystopische Parallelwelt über, die der unseren erschreckender Weise gar nicht so fremd ist, wie sie zunächst scheint. Damit schreibt sie nicht nur vehement gegen unsere vorgefertigten Bilder im Kopf an, sondern entlarvt auch die Willkürlichkeit von rassifizierten Zuschreibungen.
Aus d. Englischen v. Christa Prummer-Lehmair u. Sonja Schuhmacher.Boje 2008.
509 S.
(vergriffen, antiquarisch erhältlich)
Black Panther. Film v. Ryan Coogler
Internationale Aufmerksamkeit erreichte das Phänomen des Afrofuturismus durch die in den USA hochgelobte Marvel-Studios-Verfilmung des Superheldencomics „Black Panther“, die Black Power (und Feminismus) ganz im Sinne der selbstermächtigenden Aneignung einer (mythisierten) afrikanischen Herkunftskultur feiert. Tatsächlich ist es längst überfällig, dass auch Superheldenfilme zentrale Schwarze Charaktere, Kulturen und Realitäten abbilden, über das globale Vermächtnis von Kolonialismus und jahrhundertelangem Rassismus nachdenken und so die afrikanische Diaspora empowern. Als solches ist die Comicadaption des afroamerikanischen Regisseurs Ryan Coogler auch zu lesen: T’Challa (Chadwick Boseman) ist neuer König von Wakanda, einer fiktiven ostafrikanischen, vor der Außenwelt durch ein Kraftfeld verborgenen Nation, die zu einer Utopie globaler Schwarzer Solidarität wird: Wakanda beherbergt nicht nur das magische Metall Vibranium, sondern produziert in perfekter Symbiose mit der Natur auch so fortschrittliche Technologie, wie sie sonst keinerorts zu finden ist. Dabei überschreibt der Film die über Jahrhunderte dominanten Erzählungen und übernimmt eine Perspektive auf die Welt, die ganz selbstverständlich den Schwarzen Protagonist*innen mit afrikanischem Akzent das Wort erteilt.Drehbuch v. Ryan Coogler u. Joe Robert Cole.
USA 2018.
135 Min.
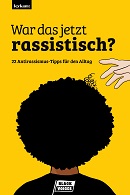

Black Voices (Hg.): War das jetzt rassistisch?
22 Antirassismus-Tipps für den Alltag
Herausgegeben von Minitta und Melanie Kandlbauer sowie Noomi Anyawu von der österreichischen Initiative Black Voices liefert dieser schmale, aber umso ansprechender gestaltete Band eine umfassende Einführung in rassistische Diskriminierungsformen und antirassistische Handlungsmöglichkeiten und fächert diese anhand eines breiten Themenspektrums auf. In 22 Beiträgen – mal essayistische Sachtexte oder Erfahrungsberichte, mal doppelseitige Bild-Text-Kombinationen – beschäftigen sich Expert*innen auf anschauliche und differenzierte Weise mit unterschiedlichen Formen der Rassifizierung: Neben Anti-Schwarzem Rassismus thematisieren die Autor*innen antisemitischen und antimuslimischen Rassismus ebenso wie Antiziganismus. Zudem zeichnet sich das Buch durch seine Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte Österreichs und deren hiesigen Kontinuitäten aus – bisher geradezu ein Alleinstellungsmerkmal. Die facettenreichen, in ehrlichem, direktem Ton gehaltenen Textformen machen eine detaillierte Auseinandersetzung mit so vielseitigen Themen wie Völkerschauen in Wien, Eurozentrismus in Landkarten oder „gute“ vs. „schlechte“ Mehrsprachigkeit möglich.
leykam 2022.
224 S.
Tupoka Ogette: Ein rassismuskritisches Alphabet
Tupoka Ogette ist im deutschsprachigen Raum als Autorin, Vermittlerin und Beraterin im Bereich (Anti-)Rassismus bekannt. Mit „exit RACISM“ (Unrast 2017) und „Und jetzt Du“ (Penguin 2022) hat sie zwei Standardwerke zu Rassismuskritik verfasst, die sich in erster Linie an erwachsene Leser*innen richten. Das bei cbj erschienene Buch ist aus einer gleichnamigen Instagram-Serie entstanden, die Ogette 2020 bis 2021 gemeinsam mit Mariam Touré entworfen hat: Jede Woche posteten sie einen Buchstaben, der – damals wie heute – von der Agentur KRAUT & KONFETTI durch reduzierte, symbolische Mittel ins Bild gesetzt wurde, und dazu einen Begriff, der mit Rassismuskritik zusammenhängt und den sie in einem kurzen Text erklärten. So machen sie nicht nur Wörter wie Ally, Gaslighting oder Misogynoir, sondern auch strukturellen Rassismus und Intersektionalität auf anschauliche Weise zugänglich. Die daraus entstandene Buchpublikation versteht sich als Impulsgeber zur weiteren Auseinandersetzung, Diskussionsgrundlage und Nachschlagewerk. In einem Vierschritt findet sich neben dem auf der linken Seite grafisch in Szene gesetzten Buchstaben eine erste Begriffsdefinition, die auf der folgenden Doppelseite von weiteren Details oder lebensweltlichen Beispielen ergänzt wird. Abschließend erhalten jugendliche Leser*innen, angeleitet von konkreten, alltagsnahen Fragen, die Möglichkeit, sich selbst in das Buch einzuschreiben, sich mit ihren eigenen Erfahrungen zu beschäftigen und sich dabei in rassismuskritischem Denken (und Handeln) zu erproben.
cbj 2022.
128 S.
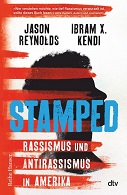
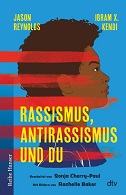
Jason Reynolds / Ibram X. Kendi: Stamped
Der eine ist einer der talentiertesten und vielschreibendsten Kinder- und Jugendbuchautor*innen der USA, der andere einer der führenden, neben Ta-Nehisi Coates aktuell wahrscheinlich der populärste Rassismusforscher in den USA: Gemeinsam haben Jason Reynolds und Ibram X. Kendi ein Jugendsachbuch verfasst, das sich anschaulich, fundiert und – soweit bei diesem Thema möglich – durchaus unterhaltsam mit der historischen Verwurzelung und Entwicklung von Rassismus und Antirassismus in den USA auseinandersetzt. Von 1415 bis heute gehen sie entlang zentraler politischer Akteur*innen sowie wichtiger literarischer und anderer künstlerischer Werke jenen Diskursen und Machtdynamiken nach, die unsere Vorstellungen über die Hierarchien zwischen Menschen festschrieben, um die Privilegien der einen und die Benachteiligungen der anderen zu legitimieren. Dabei will das Buch dezidiert kein klassisches Geschichtsbuch sein und verzichtet daher auf trockene Auflistungen von (Jahres-)Zahlen und historischen Fakten. Stattdessen bringt es den Leser*innen seinen Stoff in einer fast narrativ, fast mündlich scheinenden Erzählsituation näher, in dem sich ein Ich bzw. über manche Strecken auch ein „Wir“ direkt an die jungen Rezipient*innen wendet. In plauderhaftem Ton stellen die beiden Verfasser (nicht nur rhetorische) Fragen an die Lesenden, rufen sie immer wieder zum Innehalten und zum Hinterfragen des soeben Gelesenen und zum Hinterfragen des soeben Dargestellten auf.
Aus d. Amerikanischen v. Anja Hansen-Schmidt u. Heike Schlatterer.
dtv 2021.
256 S.
Jason Reynolds / Ibram X. Kendi: Rassismus, Antirassismus und du
Wie in ihrem Vorgängerband wenden sich Jason Reynolds und Ibram X. Kendi in „Rassismus, Antirassismus und du“ in plauderhaftem, fast launischem Ton direkt an ihre Leser*innen, wodurch sie die behandelten Inhalte besonders eindringlich zu vermitteln vermögen. In verschiedenen Textformen, kombiniert mit Schwarz-Weiß-Illustrationen, rollt das Buch die diskursive Entstehung und Verbreitung jener Erzählung auf, die die Strukturen und Institutionen unserer globalisierten Welt prägt. Dem Narrativ der (vermeintlichen) Überlegenheit weißer Menschen nähern sich die beiden Autoren in ihrer Wissen(schaft)sgeschichte des Rassismus mit Fokus auf die USA an. Gerade mit Blick auf die Aufarbeitung der Wurzeln von Rassismus nimmt aber auch Europa eine nicht unbedeutende Rolle ein. Indem sie aufzeigen, welche Macht Geschichte(n) innewohnt, dekonstruieren die Verfasser nicht nur idealisierte Mythen bekannter Personen wie Thomas Jefferson oder Abraham Lincoln, sondern betonen auch die bedeutende Rolle afroamerikanischer und queerer Frauen wie Sojourner Truth, Angela Davis oder Audre Lordeim und erkunden neben der Bürgerrechtsbewegung und Black-Lives-Matter auch popkulturelle Protestformen wie Hip-Hop.
Aus d. Amerikanischen v. Anja Hansen-Schmidt.
dtv 2022.
160 S.
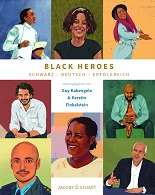
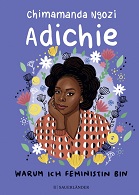
Guy Kabengele / Kerstin Finkelstein: Black Heroes. Schwarz – Deutsch – Erfolgreich
In „Black Heroes“ stellen Guy Kabengele und Kerstin Finkelstein-Kabengele 22 Schwarze Deutsche vor, die unterschiedlichste Berufe ausüben und in den von Ayşe Klinge illustrierten Porträts selbst zu Wort kommen. In mündlich-plauderhaftem Ton berichten sie von ihren persönlichen, intersektionalen Erfahrungen als Schwarze Menschen in Deutschland, ihren vielfältigen Alltagsrealitäten und ihrem Umgang mit strukturellem Rassismus. Sie erzählen von ihren Diskriminierungserfahrungen in der Schule und im Beruf, aber auch von ihren eigenen Erwartungen und Wünschen an jene Gesellschaft, zu der sie sich zugehörig fühlen. Die Pluralität afrodeutscher Lebenswirklichkeiten verdeutlichen die Verfasser*innen nicht zuletzt dadurch, dass sie die (durchaus auch ambivalente, manchmal sogar widersprüchliche) Polyphonie dieser heterogenen Stimmen und Positionen unkommentiert nebeneinander bestehen lassen. Die zugängliche Herangehensweise, das ansprechende Layout und die direkte Leser*innenansprache tun ihr Übriges, um das Buch zu einer bereichernden Lektüre für Leser*innen unterschiedlichen Alters und kultureller Verortung zu machen.
Illustriert v. Ayşe Klinge.
Jacoby & Stuart 2021.
152 S.
Chimamanda Ngozi Adichie: Warum ich Feministin bin
Warum stößt Feminismus heute immer wieder auf Ablehnung? Wieso scheuen manche davor, sich als „Feminist*in“ zu bezeichnen? Und warum ist es gerade mit Blick auf diese Tendenzen von immenser Bedeutung, für Geschlechtergerechtigkeit einzutreten? Fragen wie diesen geht die nigerianische Autorin in ihrem Buch „Warum ich Feministin bin“ nach. Auf wenig mehr als 60 Seiten zeichnet sie ihren persönlichen, selbstbestimmten Zugang zu Feminismus nach. Der Text basiert auf dem TED-Talk „We Should All Be Feminists“, den die international erfolgreiche Schriftstellerin 2012 gehalten hat. Darin warf Adichie einen kritischen Blick auf die Erwartungen, die in unserer Gesellschaft an Mädchen und Jungen herangetragen werden, die Sprach- und Verhaltensweisen, die ihnen im Alltag vorgelebt werden, und die Normen, anhand derer sie gemessen und bewertet werden. Für diese Buchausgabe hat die deutsche Künstlerin Nursima Nas nun eine besondere grafische Ästhetik entworfen: Zum Gestaltungsprinzip der in frischen Farben gehaltenen Doppelseiten werden jene einander überlagernden, kreisförmigen Flächen, auf denen zumeist auch der Text platziert wird. Einzelne Passagen der Rede werden handschriftlich nachgezeichnet und so hervorgehoben, während darstellende Zeichnungen die lebensweltlichen Beispiele aus Adichies Biografie veranschaulichen. Auch schwerer zu fassende Konzepte wie „ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt“ werden so verständlich aufbereitet und in einer kindlichen sowie jugendlichen Erfahrungswelt greifbar gemacht.
Illustriert v. Nursima Nas.
Aus d. Amerikanischen v. Alexandra Ernst.
FISCHER Sauerläner 2022.
160 S.


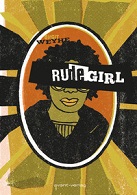
Alois Prinz: I have a dream
Im Jänner 2019 wäre der Bürgerrechtler Martin Luther King 90 Jahre alt geworden. Wäre – hätte sein Leben nicht mit nur 39 Jahren durch einen einzelnen Pistolenschuss eines Rassisten geendet. Bereits 2018 publizierte Alois Prinz, einer der renommiertesten Biografen der Gegenwart, bei Suhrkamp als Insel Taschenbuch eine kurze, bebilderte King-Biographie für Erwachsene, darauf folgte bei Gabriel ein deutlich umfangreicheres Buch für Jugendliche ab etwa 13 Jahren. Wie immer nimmt er als Ausgangspunkt einen zentralen Moment im Leben des porträtierten Menschen: Hier ein Gespräch, in dem King im Sommer 1966 in einer trostlosen Gegend von Chicago versucht, aufgebrachten und hoffnungslosen Jugendlichen jene Idee nahezubringen, von der er zutiefst überzeugt war: Gewaltlosigkeit. Im chronologischen Nachvollziehen seines Werdeganges wird ausführlich auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Nordamerika der 1950er und 1960er Jahre eingegangen. Mit historischer Genauigkeit und viel Gespür für das Innenleben des später zur Ikone gewordenen Aktivisten zeigt Prinz, wie dieser weder geplant noch gewollt zur zentralen und exponierten Figur einer Bewegung wurde, die sich beharrlich und unter großen Opfern der strukturellen Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung entgegenstellte.
Thienemann 2019.
256 S.
Fabrizio Silei: Der Bus von Rosa Parks
Ben wundert sich, dass sein Großvater mit ihm ausgerechnet nach Detroit ins Henry Ford-Museum fährt, ist er doch weder ein Autofan noch hat er einen Führerschein. Doch jener Bus, den ihm der Großvater zeigen will, erzählt nicht von Mobilitätsgeschichte, sondern vielmehr davon, was ein mutig ausgesprochenes NEIN! für Folgen haben kann. Während der Großvater erzählt, wie das war, im Alabama der 1950er Jahre, wechseln die großflächig gemalten Ölbilder von der Farbenvielfalt der Gegenwart ins Schwarz-Weiß der Vergangenheit. So werden nicht nur die unterschiedlichen Zeitebenen raffiniert markiert, sondern auch dargestellt, was sich seitdem verändert hat. Die Erzählungen des Großvaters sparen grausame Begebenheit wie Lynchmorde durch den Ku-Klux-Klan nicht aus – lange bleibt für den Enkel unklar, was genau diese Geschichten jetzt mit dem Bus zu tun haben. Bis die Rede auf jenen Abend kommt, an dem eine Frau namens Rosa Parks beschloss, ihren Sitzplatz nicht für einen Weißen freizugeben: Unter dem Blick dieser zarten und entschlossenen Frau fühlte ich mich auf einmal ganz klein. So nahm der Montgomery Bus Boycott seinen Anfang, der schließlich zur gesetzlichen Aufhebung der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln führte. Wenn Ben nun auf exakt jenem Busplatz sitzt, kommen Weltgeschichte und individuelles Erleben zusammen – und wenn Großvater und Enkel miteinander unbeschwert ein Eis essen gehen, wird deutlich, dass sich Rosas Mut gelohnt hat.
Illustriert v. Maurizio A.C. Quarello.
Aus d. Italienischen v. Sarah Pasquay.
Jacoby & Stuart 2011.
40 S.
Birgit Weyhe: Rude Girl
Bereits in ihren früheren Werken hat die mehrfach ausgezeichnete deutsche Comickünstlerin unterschiedliche Formen des biografischen Erzählens erkundet. In ihrer neuen, ursprünglich für den „Tagesspiegel“ entstandenen und nun in einem Band gesammelten Comicserie „Rude Girl“ folgt sie den Spuren der afroamerikanischen Germanistin Priscilla Layne, deren Eltern aus Barbados und Jamaika stammen – und findet dafür eine besondere Form: Die aus ihrer Feder stammenden Lebensgeschichte ergänzt Birgit Weyhe durch eine metareflexive Ebene und bringt erstere so in einen (selbst-)kritischen Austausch mit der Biografierten. Regelmäßig werden die biografischen Episoden durch einfarbige Szenen in zurückgenommenem Pastellorange durchbrochen, in denen Layne das von Weyhe in einer Mischung aus Grün, Orangbraun, Schwarz und Weiß Erzählte und Gezeichnete wortwörtlich in die Hand nimmt, rezipiert, kommentiert, ergänzt und teilweise auch korrigiert. Die von Priscilla Layne eingebrachten Aspekte greift Birgit Weyhe immer wieder explizit auf und verändert als Antwort darauf teilweise auch ihre künstlerische Zugangsweise. Im Dialog mit der Biografierten entsteht so eine vielstimmige Graphic Novel, in der das gemeinsame Erzählen und voneinander Lernen vor eine vermeintliche Autorität von Autor*innenschaft tritt.
avant 2022.
312 S.
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem ungebrochen aktuellen Thema #BlackLivesMatter in der Jugendliteratur fand in Claudia Sackls Beitrag „Jenseits des Hashtags“ in der Schwerpunktnummer Black von 1001 Buch statt. Zur Verfügung gestellt wird der Artikel gemeinsam mit anderen ausgewählten Fachbeiträgen im internen STUBE-Card-Bereich.
Wer noch keine STUBE-Card besitzt, findet >>> hier Informationen und Bestellformular.