Thema: Märchenausgaben im Hans Christian Andersen-Jahr


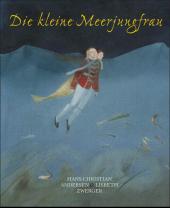
Hans Christian Andersen / Joel Stewart: Das große Märchenbuch
Als Theater im Kopf - oder wenn man es so will: als Abenteuer im Kopf - präsentiert der englische Künstler die Märchenwelt des Hans Christian Andersen: An den Beginn stellt er ein Porträt des Dichters selbst. Dessen kreatives "Hinterstübchen" verbildlicht er durch eine kleine Guckkastenbühne mit samtrotem Vorhang - der im Folgenden Märchen für Märchen hochgezogen wird. Vorerst spärlich arrangierte Requisiten wandeln sich dabei rasch in eine dynamische Bebilderung der jeweiligen Geschichten, zahlreiche Skizzen und Vignetten lenken den Blick auf einzelne Figuren und Geschehnismomente. Bis schließlich einzelne Szenen zentral herausgearbeitet werden. Verwendet werden dunkle, deckende Farben, mit deren Hilfe jene Momente besondere Aufmerksamkeit erlangen, in denen die Unklarheit des jeweiligen Schicksals am deutlichsten scheint. Eine auch in der Buchgestaltung (Farbleitsystem unterstützt durch grafische Kennzeichnung, kurzen Angaben über die Entstehung, Wirkung und Bedeutung der jeweiligen Märchen, kurze Biografie Andersens) umsichtig ausgestattete Ausgabe.
Aus dem Engl. v. Thyra Dohrenburg.
Sauerländer 2004.
208 S.
Hans Christian Andersen / Nikolaus Heidelbach: Märchen
Knapp 10 Jahre nach seiner Aufsehen erregenden illustratorischen Annäherung an die Märchenwelt der Brüder Grimm nimmt sich der deutsche Illustrator nun des dänischen Märchenerzählers an. Unbeeinflusst von der oft deutlich jenseits der Kitschgrenze wandelnden medialen Rezeptionsgeschichte der Andersen-Märchen befragt Nikolaus Heidelbach Text um Text nach seiner eigentlichen Motivik - und legt dabei das Unheilvolle dieser Märchen Stück um Stück frei. Es sind nicht die traditionell illustrierten Szenen, denen er Aufmerksamkeit schenkt; vielmehr verfestigen sich Sehnsüchte und Hierarchien in den Bildkompositionen, lenken wie nebenbei platzierte Requisiten den Blick auf das bisher oft noch gar nicht Wahrgenommene. Und plötzlich wird das Märchen wieder zu einer Textsorte, die einen schaudern und trauern und gleichzeitig erkennen lässt, wie sehr diese Märchen das Eigentliche berühren.
Beltz & Gelberg 2009.
372 S.
Hans Christian Andersen / Lisbeth Zwerger: Die kleine Meerjungfrau
Die Geschichte der kleinen Meerjungfrau und ihrer unendlichen Sehnsucht nach einer unsterblichen Seele zählt wohl zu den traurigsten Märchen überhaupt - auch wenn Disneys Arielle den Blick auf das eigentliches Schicksal des Meerwesens verstellt, das lieber sich selbst als den geliebten Prinzen opfert. Unendlich zerbrechlich und unendlich allein zeigt die Illustratorin Lisbeth Zwerger das Mädchen an der Reling des Schiffes stehen, auf dem der Geliebte soeben seine Hochzeitsnacht mit einer anderen verbracht hat. Das Kleid erinnert an die Schuppen des Fischschwanzes und aus der tiefblauen Nacht dringt in der Ferne das Morgenlicht, das die Glücklose zu Schaum auf den Kronen des Meeres verwandeln wird. Lisbeth Zwerger rückt die unerfüllte Sehnsucht der kleinen Meerjungfrau in den Mittelpunkt - und zeigt mit der Distanz, aus der sie den Blick auf ihre Figuren wirft, bereits die Unerfüllbarkeit dieser Sehnsucht an: In einer Welt, die vom Mythos und der Meerhexe bestimmt wird, führt selbstbestimmtes Handeln konsequent ins Verderben.
Michael Neugebauer Edition 2004.
48 S.



Hans Christian Andersen / Linda Wolfsgruber: Däumelinchen
Aus Sehnsucht nach einem Kind sucht eine Frau eine Hexe auf - und bekommt ein Gerstenkorn von ihr überreicht. Und tatsächlich entsteigt wenig später ein kleines Mädchen der daraus entwachsenen Blume. Mit großer Kunstfertigkeit wird das filigrane Wesen von der Künstlerin Linda Wolfsgruber in eine Märchenwelt gestellt, in der sich größere und gröbere Wesen das kleine Mädchen dienbar machen wollen: Von einer Kröte als Braut für deren Sohn entführt, von einer Maus jahrelang als festgehalten findet das Däumelinchen letztlich in einer fast schon dem Tod anheimgegebenen Schwalbe ihre Liebe. Wolfsgruber unterlegt ihre Radierungen mit jeweils einer Grundfarbe und erzeugt so eine Stimmung steter Unsicherheit -betont damit jedoch auch Sehnsucht und Mut, die das nussschalengroße Däumelinchen lenken.
Bibliothek der Provinz 2004.
50 S.
Hans Christian Andersen / John Alfred Rowe: Des Kaisers neue Kleider
Rotbäckig, runder Bauch, Beinchen so filigran, dass sie unter dem eigenen Körpergewicht zusammenzubrechen drohen, und eine kugelrunde rote Clownnase - dieserart tritt uns John Rowes Kaiser entgegen: Ein Mittelding aus "gschamster Diener", Zirkusdirektor und freudig erregtem Kleinkind, das in eine knallig bunte und karnevalesk überzeichnete Landschaft gestellt wird. Anthropomorphisierte Tierfiguren bevölkern sein Kaiserreich und werden durch ihre menschlich inspirierte Überzeichnung zu eindeutig kategorisierbaren Typen: Es tummeln sich fiese Füchse und angepasste Affen neben ehrenwerten Eulen. Die eigenwillige Dynamik der Bilder unterstreicht deren Willen zur Heiterkeit - und korrespondiert mit der abgeänderten Schlusssequenz: Hier nämlich mündet die dechiffrierte keineswegs in beschämten Machtverlust, sondern in die Ausrufung eines Kaiser-Ohne-Kleider-Tages - und das Fest kann weitergehen...
Michael Neugebauer Edition 2004.
34 S.
Hans Christian Andersen: Der Kaisers neue Kleider und andere Märchen
Eine kleine, feine Auswahl an zehn Andersen-Märchen, die sowohl Weltbekanntes wie "Der standhafte Zinnsoldat" als auch stets neu zu Entdeckendes enthält, wie die gruselig-phantastische Geschichte Schatten oder die Satire vom Hemdkragen. Herausgeber Ulrich Sonnenberg liegt - wie er in einem Nachwort über die Erneuerung des Märchengenres durch den dänischen Dichters erklärt - an der Direktheit, dem Humor und der Doppelbödigkeit in Andersens Ouevre. In Rotraut Susanne Berner findet er dafür eine (wie man so schön sagt) kongeniale Partnerin, liegt ihre große Kunst doch darin, in ihren Bildern das allumfassende einzufangen und es in seiner Schlichtheit für neue Bedeutungszusammenhänge zu öffnen. Und so darf man über die als Kleidungsstück im Schrank verwahrte "Nacktheit" des Kaisers schmunzeln, einen vom Sentiment befreiten und doch berührenden Blick auf das sterbende Märchen mit den Schwefelhölzchen werfen und sich letztlich von der Prinzessin mit dem Floh im Ohr Giraffenkeule servieren lassen. Mit einem Wort: Ein Genuss.
Hg. v. Ulrich Sonnenberg.
Mit Bildern von Rotraut Susanne Berner.
Insel Verlag 2005.
96 S.

Hans Christian Andersen / Melanie Kemmler: Die Prinzessin auf der Erbse
Als "wirkliche" oder (je nach Übersetzung) "wahre" Geschichte kennzeichnet Hans Christian Andersen das Märchen der "Prinzessin auf de Erbse" mit dessen Schlusssatz. Wohl auch deswegen erscheint es heute fast nicht mehr möglich, ohne ironische Brechung von der elitären Aussonderung des Prinzen bei seiner Brautwahl zu erzählen. Vielmehr sind es humorige Verdrehungen der Geschichte, die heute gerne erzählt werden.
Die Illustratorin Melanie Kemmler jedoch geht einen ganz anderen Weg. Sie vermittelt den schmerzlichen Anachronismus des Märchens über ihre Raumgestaltung: Leer und damit wohl auch sinnentleert wirkt das Schloss, in das sie ihren Prinzen und dessen Eltern stellt. Groß, hell und lichtdurchflutet sind die Zimmer, mit Blick nach draußen - und trotzdem scheint es weder ein "Dahinter" noch Leben in den Räumen zu geben. Das Moment der Inszenierung und der Künstlichkeit wird dabei auf verhaltene Weise sichtbar - bis hin zur Kunstkammer, die - nachdem das Märchen sein glückliches Ende genommen hat - nicht nur Dürers Hasen (mit oder ohne Transportberechtigung) und die historische Erbse birgt, sondern auch bereits zum Kunstobjekt gewordene Szenerien der vorangegangenen Geschichte. Vor diesem Hintergrund entfalten der sich sehnsuchtsvoll verlierende Prinz und seine wohl auch ein wenig an ihrem Schicksal leidende Prinzessin ihre faszinierende - und schlicht rührende - Präsenz.
Aufbau 2005.
24 S.
