Bücher für Erstleser*innen und das frühe Lesealter
Bücher für Erstleser*innen
Unmittelbar während des Leselernprozesses Kinderbücher anzubieten, ist eine Herausforderung. In diesem Fall ist es gut, sich nicht von Angeboten locken zu lassen, die den Markt überschwemmen, und sich mit ausdifferenzierten minimalen Lesestufen oder einem Mix aus Bildchen und Schrifttext eher an verunsicherte (oder enthusiasmierte) Eltern richten, als wirklich gut geeignet für das Lesen lernende Kind sind. An dieser Stelle sind hingegen Bücher zu finden, die in ihrer Textgestaltung am Lesen lernenden Kind orientiert sind und dennoch über diese kurze Phase hinaus Bestand als liebenswerte Geschichten und klug gemachte Bücher haben. Damit soll auch für all jene eine Ersteinführung möglich werden, die wenig Erfahrung mit moderner Kinderliteratur haben - für den ersten privaten Bestandaufsbau und das gemeinsame Lesen in der Familie.


Paul Maar: Das Tier-ABC
Angelehnt an Fibeln wird hier nach dem ABC vorgegangen: Die Buchstaben werden am oberen Bildrand präsentiert und jeweils verknüpft mit einem kurzen Reim über ein spezifisches Tier mit ebendiesem Anfangsbuchstaben (vom Auerhahn bis Zebra). Im Sinne des Leselernprozesses, in dem nach dem Entzifferungs-erfolg Verschnaufpausen gut sind, werden diese dreiteiligen, rhythmisierten Verse über die Seite verteilt und an jeweils eine farbstarke Illustration gebunden. Das Wiederholungsmoment ist in den Vers eingebaut: Je zweimal wird das Tier benannt, bevor es in einen witzigen, vermenschlichten Aktions-Zusammenhang gestellt wird.
Dem Igel, / dem Igel, / nützt weder Kamm noch Spiegel heißt es da, während man den Igel dabei beobachtet, wie er sich mit einer Haarbürste abmüht.
Der Jaguar, / der Jaguar, / ist manches Mal fast unsichtbar. Dann nämlich, wenn er auf dem Stoff-Sofa im Jaguardesign fläzt. Gesucht werden kann also nach Buchstaben, die einem schon vertraut sind. Das Kind kann selbst Blättern und entdecken – und wird wohl irgendwann auch einmal wissen wollen, wovon die Minitexte handeln. Davor kann das Buch im Sinne des Lesens vor dem Lesen vorgelesen werden; und auch wenn man schon Lesen kann, bleibt das Buch ein humoriger Lyrik-Band.
Ill. v. Tina Schulte.
Oetinger 2004.
64 S.
Charlotte Habersack / Sasanne Göhlich: Torkel
Eigentlich handelt es sich hier um eine Bildgeschichte, die kindliche Aktionsszenen einfängt. Gleich am Beginn lauert Torkel Jona auf: Kuckuck! ruft er und lugt überraschend hinter einer Hausecke hervor. Mann, Torkel, hast du mich erschreckt! Der Schreck resultiert jedoch nicht aus der Tatsache, dass es sich bei Torkel um eine Giraffe handelt. Vielmehr sorgt der Überraschungsmoment, dafür, dass Jona sich auf den Allerwertesten setzt – und dabei das Knie (???) aufschlägt. Nun gut, dies ist kein anatomisches Grundlagen-buch, sondern eine Freundschaftsgeschichte. Während sich Jona also (per herbeigeholten Doktorköfferchen) selbst verarztet, lässt sich ganz wunderbar darüber parlieren, was eigentlich die Jahreszeiten sind. Die Antwort erfolgt in sprachlich ganz reduzierten Passagen, oft Ein-Wort-Sätzen, oft schlichten Formulierungen, die auch in zusammengesetzten Satzkonstruk-tionen leicht zu dechiffrieren sind: Im Frühling, da ist Ostern. Im Sommer geht man baden …
Der Reiz entsteht natürlich aus der Bild-Text-Kombination: Die minimalistischen Texteinheiten sind ganz leicht zu lesen und werden mit liebenswerten Illustrationen kombiniert, in denen Torkel Schlitten fahren und im Planschbecken einen sommerlichen Zitronen-Drink zu sich nehmen darf.
Tulipan 2019.
48 S.
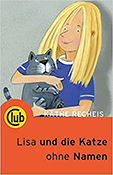

Käthe Recheis: Lisa und die Katze ohne Namen.
Im Rahmen der Club-Taschenbücher des Österreichischen Buchklubs wurde ein Kinderroman der renommierten Autorin Käthe Recheis neu aufgelegt, der sprachlich und formal so raffiniert gestaltet ist, dass er sich auch für Erstleser*innen eignet. Gesetzt wird dabei auf einfache Satzkonstruktionen, die in so genannten Sinnzeilen-Einheiten präsentiert werden. Gemeint ist damit, dass ein Zeilenumbruch sofort erfolgt, wenn eine Sinn-Einheit innerhalb des Satzes abgeschlossen ist:
Alle hatten die Zwillinge gern,
nicht nur Papa und Mama,
auch die Nachbarn,
die Onkel und Tanten
und die Freunde der Familie.
Man kann im mühsamen frühen Leseprozess also die Zeilen wechseln, ohne dass Informationen verloren gehen; ohne dass Bedeutungen, die in einer Zeile aufgeworfen werden, erst in der nächsten Zeile zu Ende geführt wurden.
Im Sinne dieser Sprachkunst der Einfachheit auch noch eine liebenswerte Geschichte über einen Geschwisterkonflikt und eine herumstreunende Katze zu erzählen, bedarf besonderen literarischen Könnens. Aber Käthe Recheis dirigiert ihre Protagonistin Lisa sprachsicher durch die Irrungen und Wirrungen, die aus der allgemeinen Begeisterung für die neuen Geschwisterchen resultieren – und dem damit verbundenen Gefühl Lisas, selbst nicht mehr wichtig zu sein.
Ill. v. Claudia de Weck.
Club Taschenbuchreihe.
Obelisk 2010.
76 S.
Paul Maar: Neles neuer Pulli.
Der Text wird hier nicht in Sinnzeilen-Einheiten, sondern „nur“ im Flattersatz gesetzt. Will heißen, dass für einen Blockabsatz notwendige Abteilungen innerhalb eines Wortes wegfallen, die Wörter am Zeilenende immer auslaufen. Dennoch eignet sich dieser Text wunderbar für Erstleser*innen und ist daher der Beispieltext im entsprechenden Skriptum im >>>Fernkurs Kinder- und Jugendliteratur der STUBE. Denn er basiert sprachlich auf dem Moment der Wiederholung – und davon ausgehend auf minimalen Wortvarianten:
Mama sagt: „Als ich ein Kind war, mochte ich Gelb am liebsten. Mein gelber Stift war der kürzeste von allen.“
Nele sagt: „Ich mag aber kein Gelb. Mir fällt auch nichts Gelbes ein, das ich malen kann.“
Gelb kommt hier in unterschiedlichen Varianten und Beugungen vor, als Subjektiv, als Adjektiv. Das sind selbstverständlich grammatikalische Kategorien, die vom Lesen lernenden Kind nicht erkannt oder bestimmt werden müssen. Sie integrieren nur bereits in den Leselernprozess die Erkenntnis, dass einzelne Wörter in unterschiedlichen Formen in einem Text auftauchen; und sie müssen immer wieder neu – in ihrer jeweiligen Form – erkannt und gelesen werden. Egal, ob man Gelb mag oder nicht. Man wird dennoch Spaß an einer Geschichte über einen ungeliebten Pullover und Abwehrstrategien dagegen haben.
Ill. v. Manuela Olten.
Tulipan 2012.
48 S.
Bücher für das frühe Lesealter
Wer nun bereits „Lesen“ kann, aber noch im Stadium der unsicheren Texterfassung ist, bedarf literarischer Angebote, die auch auf diese Phase der Erlangung erster Lesekompetenz Rücksicht nehmen. Die Textgestaltungen können hier vielfältiger und komplexer werden, sollen aber immer noch Grundlagen der Einfachheit in Satzlänge und Satzbau implizieren. Dafür können die Geschichten selbst nun ein wenig herausfordernder sein und damit auch eine erste Einübung in gesamttextliche Formgebungen und erzähltheoretische Aspekte ermöglichen.
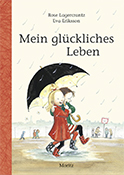

Rose Lagercrantz: Mein glückliches Leben.
Mittlerweile ist das Erzählen über Dunne auf sieben Bände angewachsen und die Mini-Serie im Buchformat damit abgeschlossen. Dunne mit ihrem ganz spezifischen Empfinden für Glück musste bis dahin zahlreiche Schicksalsschläge hinnehmen; doch immer war klar, dass Glück nicht dasselbe ist, wie die Abwesenheit von Unglück. Letztlich aber schließt sich der Kreis von Dunnes kindlichen Glücksmomenten über ihre Freundschaft mit Ella-Frida bis hin zur Zufriedenheit des Vaters, dessen Leben Dunne handlungsfreudig in die richtigen Bahnen zu lenken weiß. Begonnen hat alles damit, dass Dunne mit der Schule beginnt und Ella-Frida kennenlernt. Als Ella-Frida nach kurzer, glückseliger Zeit wegziehen muss, wird offensichtlich, dass dieses Verlusterlebnis ein viel umfassenderes sichtbar macht:
Man sagt, dass Mama weggegangen ist, obwohl sie nicht mehr gehen konnte. Und weg – wo liegt das?
Jetzt ist Ella-Frida auch weg. Aber sie ist nicht gegangen. Sie ist in einem Auto weggefahren.
Nach Norrköping.
Der einfache Sprachgebrauch und übersichtliche Satzbau werden auf wunderbare Weise mit den Bedeutungsvarianten von Worten und Sprachbildern kombiniert. Sodass eine kinderliterarische Kategorie der Einfachheit verwoben wird mit linguistischen Annäherungen an ein kindliches Erleben. Und damit wird der Erwerb der frühen Lesekompetenz mit der Erlangung von Literatur- und Lektürekompetenz verbunden.
Selten, und das gilt für alle Bände, ist so unprätentiös von Glücksmomenten zu lesen gewesen, die aus einem kindlichen Alltag resultieren, in dem die Freude am Gelingen des Lebens an sich die Weltsicht bestimmt. In der hauchzarten sprachlichen Realisierung ebenso wie in den feinlinigen Schwarzweißzeich-nungen werden dabei jene Beziehungsgeflechte geknüpft, in denen das "geglücke" sich zu entfalten vermag.
Ill. v. Eva Eriksson
Aus dem Schwed. von Angelika Kutsch.
Moritz 2011.
138 S.
Megumi Iwasa: Viele Grüße, Deine Giraffe
Die ganze Zeit in der südafrikanischen Savanne herumzusitzen vermag eine*n auf Dauer nicht wirklich auszufüllen. Ja mehr noch: Es ist langweilig. Giraffe möchte diesem Zustand der Ödnis Abhilfe verschaffen und entschließt sich zu einem wagemutigen Schritt: Sie schreibt einen Brief. Wer hätte gedacht, dass daraus nicht nur überraschende postalische Tätigkeiten resultieren, sondern auch eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Kontinenten und Klimazonen? Denn auch unter Pinguinen ist der Wissenshunger groß. Und so entspinnt sich eine Geschichte über Diversität, die in eine sehr klug am frühen Lesealter ausgerichtete Textgestaltung dennoch einen für dieses Lesealter ungewöhnlichen Aspekt mit einbezieht: den Perspektivenwechsel. Darüber hinaus werden in den Prosatext Briefe montiert – grafisch abgegrenzt und in handschriftlichen Versionen, sodass die Druckschrift mit der (mittlerweile leider oft verpönten) Schreibschrift und einer individuellen Form einer Versalienschrift kombiniert wird. Dieserart werden überraschende Fragen aufgeworfen: Warum zum Beispiel hat die Giraffe einen Hals, der Pinguin aber nicht? Nun, biologische Details wie dieses lassen sich prima bei einer multikulturellen Teestunde im Eisschollenambiente klären und schriftlich dokumentiert per Flaschenpost hinaus in die Welt tragen …Ill. v. Jörg Mühle.
Aus dem Jap. v. Ursula Gräfe.
Moritz 2017.
107 S.

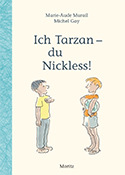
Gudrun Likar: Prinzessin Fibi und der Drache
Fibi hasste es, eine Prinzessin zu sein. Mit diesem radikalen ersten Satz wird klar: Prinzessin Fibi ist nicht glücklich mit den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Damit wird aber auch dort, wo erstmals selbst gelesen wird klar, was im Idealfall durch das „Lesen vor dem Lesen“ bereits grundgelegt werden konnte: Literatur etabliert Rollenmuster, verwirft Rollenmuster, schafft Rollenmuster neu. Das Lesen vor dem Lesen, das auf dem familiären Vorlesen und Miteinander-Lesen gleichermaßen wie kreativer Literaturvermittlung in Kindergärten und Bibliotheken basiert, schafft also Kompetenzen im Verständnis von Text-Zusammenhängen, die nun – beim Selberlesen eines im Flattersatz gesetzten Textes – neu aufgerufen werden können. Erzählt wird hier kurzweilig und dialogreich, wenn Fibi mitansehen muss, dass zahlreiche selbsternannte Drachentöter in ihrem Reich scheitern. Also beschließt sie, das Problem mit einem schlecht gelaunten Drachen selbst in die Hand zu nehmen. Und kommt als Einzige auf die Idee, ihn zu fragen, warum er eigentlich so zornig ist. Die Antwort erfordert nicht nur einen drastischen Eingriff, für den Fibis Werkzeugkoffer von großem Nutzen ist, sondern zeigt auch, dass unterschiedliche Sprechweisen in einem Text grafisch voneinander unterschieden werden können. Das schmerzvolle Bekenntnis des Drachen nämlich ist auch in schmerzvoller roter Schriftfarbe gesetzt. Begleitet von einem in die Illustrationen integrierten AUUUAAAAAAAAAAAOOOOOO.
lll. v. Sabine Büchner.
Tulipan 2009.
42 S.
Marie-Aude Murail: Ich Tarzan - du Nickless!
1887 veröffentlichte der polnische Arzt Ludwik Lejzer Zamenhof eine Abhandlung über eine internationale Sprache. Das Pseudonym, das er für seine Publikation verwendete, war Dr. Esperanto. Ein Satz wie „Ichtazan gabumm wullass“ macht Ludwik Lejzer Zamenhof alle Ehre; denn auch wenn der kindliche Ich-Erzähler keine Ahnung von Esperanto hat, kreiert der vife Franzose während seines Urlaubs lustvoll eine Plansprache. Als er am Campingplatz einen etwa Gleichaltrigen („Nickless“?) kennenlernt, versagen nicht nur die nationalsprachlichen, sondern auch die medialen Codes. Doch Nickless nimmt Jean-Charles spontan entwickeltes Lautsystem begierig auf. Mit Witz und Esprit wird über eine sommerliche Sprachverwirrung erzählt, die ihren Reiz dadurch erhält, dass die Sprache selbst für jene zum Thema wird, denen im Leseprozess auch die eigene Sprache ein wenig seltsam erscheinen mag. Damit wird das Moment des Sprachspiels, mit dem Kinder durch Bilderbuch, Kinderlieder oder Lyrik-Angebote zum Zeitpunkt des Lesenlernens schon vertraut sind, in den Lektüreprozess integriert und schafft Entlastung. Falsch gibt es hier nicht. Nur Eigenkreativität.
lll. v. Michel Gay.
Aus dem Frz. v. Paula Peretti.
Moritz 2011.
56 S.
Sie wollen nicht nur ein Kind mit einem Buch beglücken, sondern im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur am Laufenden bleiben?
Unser >>>Newsletter hilft dabei und informiert Sie über alle neuen Angebote der STUBE, über neue Themenlisten, über Neuvorstellungen im Rahmen des STUBE-Freitag und vieles mehr.
