Thema:Shoah und Widerstand
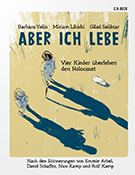
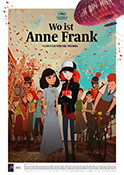
Barbara Yelin / Miriam Libicki / Gilad Seliktar: Aber ich lebe. Vier Kinder überleben den Holocaust
Dass die Graphic Novel ein beliebtes Genre ist, um über die Shoah zu erzählen, zeigt sich in dieser Liste des Öfteren. Einen ganz besonderen Weg gehen die Künstler*innen Barbara Yelin, Miriam Libicki und Gilad Seliktar, die in je individuellem Strich und unverkennbarem Zeichenstil nicht auf das Leben im Konzentrationslager, sondern vielmehr auf vier individuelle Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs und die Erinnerungen daran fokussieren. Damit werden Aspekte der Zeitgeschichte in den Blick genommen, die wahrscheinlich weniger bekannt sind. Die Einschreibung der Erinnerung in die drei voneinander entkoppelten Erzählungen, die in ihrer Individualität und Drastik beeindrucken, lässt innehalten und den Atem stocken. Der ausführliche Anhang dokumentiert die Entstehung und Durchführung dieses engagierten Projekts und nimmt eine historische Verortung der Ereignisse vor, ohne in seiner Ausführlichkeit den Erinnerungen der Zeitzeug*innen Raum zu nehmen. Barbara Yelin hat überdies die Biografie von Emmie Arbel in einer eigenständigen Graphic Novel mit dem Titel „Die Farbe der Erinnerung“ eindrücklich ins Bild gesetzt.
Nach den Erinnerungen von Emmie Arbel, David Schaffer, Nico Kamp und Rolf Kamp.
Aus dem Engl. von Rita Seuß.
Hg. v. Charlotte Schallié.
Beck 2022.
175 S.
Wo ist Anne Frank?
Das ikonische rotkarierte Tagebuch wird hier zum Ausgangspunkt einer Geschichte, in der Ari Folman, selbst in einer Familie von Holocaust-Überlebenden aufgewachsen, das Schicksal von Anne Frank gleichermaßen nacherzählt wie den Bogen ins Heute spannt. Und das in zwei Medien: einem Animationsfilm, an dem er unglaubliche 8 Jahre arbeitete, und einer dazu gemeinsam mit der israelischen Künstlerin Lena Guberman erarbeiteten Graphic Novel (die auch für den Film als Character Designer tätig war). Durch ein Unwetter zerbirst jene Vitrine, in der im Amsterdamer Anne Frank Haus das Original-Tagebuch ausgestellt wird. Den Seiten entspringt ein rothaariges junges Mädchen: Kitty, jenes fiktive Gegenüber, an das Anne ihre Tagebucheinträge adressierte. Ungläubig beobachtet sie, wie jenes Haus, in dem sich Anne einst versteckte, nun von Menschen aus aller Welt besucht wird. In einem gekonnten Verschränken zwischen der Jetzt-Zeit und der Vergangenheit wird so gleichermaßen erzählt, wie es der Familie im Versteck erging, als auch, welche Rolle im Heute die Erinnerung an Anne, nicht zuletzt durch die Benennung von Schule, Theater und Brücke nach ihr, spielt. Während die Öffentlichkeit bestürzt über das Verschwinden des Tagebuchs ist, erlebt Kitty in der Begegnung mit einem Jungen namens Peter, in welcher Not geflüchtete Menschen sich in den Niederlanden der Jetzt-Zeit befinden. Und beschließt zu handeln…
Film von Ari Folman. Belgien u.a. 2021. 104 min.
Graphic Novel von Ari Folman und Lena Guberman. Aus dem Engl. v. Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. Fischer 2021. 160 S.
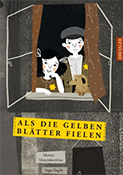
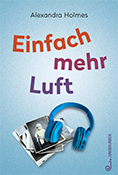
Marius Marcinkevicius und Inga Dagilė: Als die gelben Blätter fielen
Vilnius, 1943: Alon führt eigentlich ein ganz normales kindliches Leben: Er isst gerne Bagel und lässt mit seiner Freundin Drachen steigen. Zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten eröffnet sich ein Leben in einem jüdischen Ghetto in Litauen, in dem er mit vielen anderen Juden und Jüdinnen lebt. Darüber hinaus ist für Alon Abschied zu etwas ganz Alltäglichem geworden. Jeden Tag verlassen Menschen das jüdische Ghetto und kommen – wie sein Vater – nicht mehr zurück. Alon wird mit der zunehmenden Schreckensherrschaft der Nationalsozialist*innen konfrontiert. Der hohe Bildanteil, in dem die Farbe Gelb die Grenze zwischen dem Ghetto und der Welt außerhalb markiert und zugleich auf die Farbe des „Judensterns“ rekurriert, ermöglicht eine erste Berührung mit dem Thema Shoah auch für ein jüngeres Lesepublikum. Zusammen mit dem prägnant sensiblen Erzählton wird – ohne den Terminus „sterben“ überzustrapazieren – deutlich, wie viele Familien aus dem Ghetto in den Tod geschickt wurden. Dabei gelingt am Ende eine Brücke zum heute und zeigt, wie Erinnern funktionieren kann.
Aus d. Litau. v. Saskia Drude.
Dressler 2024.
56 S
Alexandra Holmes: Einfach mehr Luft.
Ein Geburtstagsessen wird zum erzählenden Rahmen eines Romans, der österreichische Zeitgeschichte aufbereitet: Die Urgroßmutter der jugendlichen Hauptfigur Ben wird 100 Jahre alt. Bei seinen Besuchen ist er immer wieder fasziniert von ihren spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten, die ihm Einblick in familiäre und politische Zusammenhänge geben. Sie werden parallel zu Bens gegenwärtigem Leben geführt, typografisch von seiner Erzählstimme abgehoben und in einem anderen Duktus gestaltet: „Sie beginnt immer mit einer Überschrift, als ob irgendjemand mitschreiben würde. Ich glaube, wenn sie alleine ist, beschäftigt sie sich die meiste Zeit damit, diese Geschichten in ihrem Kopf zu ordnen. Die autorisierte Fassung erzählt sie dann druckreif.“ Ein kluger erzählerischer Kunstgriff, um Begebenheiten aus der Geschichte am Beispiel persönlicher Schicksale aufzuarbeiten. In diesem Kontrast wird deutlich, wie jede Generation – neben ihren individuellen Lebenserfahrungen – auch von historischen Begebenheiten geprägt wird. Und wie besonders traumatische Erfahrungen wie jene der Shoah an spätere Generationen weitergegeben werden: Denn es ist kein Zufall, dass Bens Großvater niemals freiwillig in einen Zug gestiegen wäre und seine Mutter auf Sommerlager ihren Koffer nie ausgepackt hat: „In ihrem tiefsten Inneren hatte sie von klein auf gespeichert, dass man jederzeit unverzüglich in der Lage sein muss, sein Zeug zu schnappen und sich aus dem Staub zu machen, so wie ihr Vater in seiner Kindheit.“
Jungbrunnen 2023.
144 S.
Martine Letterie: Kinder mit Stern.
Die Zerstörung jüdischen Lebens durch die Shoah kam nicht plötzlich, sie begann mit immer restriktiver werdenden Diskriminierungen jüdischer Menschen, die überall dort umgesetzt wurden, wo die deutsche Wehrmacht einmarschierte. Hier wird davon erzählt, wie sich das Leben jüdischer Kinder in den Niederlanden radikal veränderte und wie schwer nachvollziehbar das für diese war: keine Schule, kein Zoobesuch, kein Fahren mit der Straßenbahn. In kurzen Episoden, die jeweils auf ein konkretes Kind in seinem familiären Umfeld fokussieren, werden diese Verstörtheiten voller trauriger, aber auch hoffnungsvoller Zwischentöne in unterschiedlichen Lebensmomenten sehr junger Menschen abgebildet. Ebenso sensibel wie der Text sind die Illustrationen der österreichischen Illustratorin Julie Völk, die durch besondere Farbgebung und gezielte Unschärfen bedrückende wie beglückende Stimmungen einfangen und spürbar machen. Martine Letterie hat für diese Geschichten auf Aufzeichnungen von Überlebenden im Erinnerungszentrum Westerbork zurückgegriffen und den „damaligen“ Kindern damit ein respektvolles literarisches Denkmal gesetzt.
Mit Ill. v. Julie Völk. Aus dem Niederländ. v. Andrea Kluitmann.
Carlsen 2019.
128 S.
Leonora Leitl: Held Hermann.
Der 12-jährige Hermann, der mit seiner Mutter, seinem älteren Bruder Kurt und seiner kleinen Schwester Hedwig in der oberösterreichischen Kleinstadt Freistadt lebt, berichtet über die familiären und politischen Ereignisse im letzten Kriegsjahr, das im Mai 1945 mit dem Eintreffen der US-truppen und der Rückkehr des Vaters von der Front endet. Konsequent aus Hermanns Sicht und Empfinden erzählt, werden seine Begegnungen, Freund-schaften, Sorgen mit seiner kindlichen Wahrnehmung der politischen und gesellschaftlichen Situation verknüpft, die er – seinem Alter gemäß – nicht immer in vollem Ausmaß durch-schauen und einordnen kann. Was hat es mit den weißen Zettelchen auf sich, die die Mutter versteckt? Was bespricht diese im Flüsterton mit seinem großen Bruder? Warum werden Angst und Anspannung der Erwachsenen immer größer, wo doch das Kriegsende nahe scheint? Doch gerade diese „Leerstellen“, Hermanns Zuordnungen und Interpretationen komplexer Zusammenhänge, die er oft nur erahnen kann, überzeugen: Das Ende des Krieges wird zugleich das Ende einer Kindheit. Die aufwändig gearbeiteten ganzseitigen Illustrationen entlang der Jahreszeiten akzentuieren gewisse Handlungsfacetten und geben dem Roman eine schlüssige Struktur.
Tyrolia 2020.
242 S.
Helen Bate: Peter in Gefahr. Mut und Hoffnung im zweiten Weltkrieg.
Die britische Künstlerin erzählt in panelartig arrangierten Szenen die wahre Geschichte des jüdischen Buben Peter, der sich in Budapest mit seiner Familie vor den Nazis verstecken musste. Sein idyllische Kinderalltag mit Fußballspielen, Kuchenessen und Schlittenfahren löst sich mit der Entrechtung und schließlich der Vertreibung aus dem Zuhause auf. Nur knapp entgeht seine Familie der Deportation und muss sich verstecken; bis dann endlich der Krieg vorbei ist und der Wiederaufbau beginnt … Helen Bates Kinderbuch mit kräftigen Zeichnungen liegt in deutscher Übersetzung von Mirjam Pressler vor. Durchgängig wird aus der Ich-Perspektive erzählt, wodurch die Erzählsituation der Zeitzeug*innenschaft geschaffen wird. Auslassungen werden somit als Entscheidung des Ich-Erzählers lesbar. Am Ende des Buches steht ein reales Fotoalbum: Inmitten einer Schar Söhne und Enkel sitzt ein erwachsener, lachender Peter, der mittlerweile mit seiner Frau in Wien wohnt. Was für eine Freude, was für ein großes Glück, seine Stimme hören zu können – und in diesem bemerkenswerten Kinderbuch verewigt zu haben, das sich an ein immer wieder kritisch hinterfragtes Projekt, das Erzählen über die Shoah für Volksschulkinder, elegant wie entschlossen heran wagt.
Aus d. Engl. v. Mirjam Pressler.
Moritz 2019.
48 S.
Anne Frank / David Polonsky / Ari Folman: Das Tagebuch der Anne Frank.
Die preisgekrönten Macher von "Waltz with Bashir", beide Nach-kommen von Überlebenden der Shoah, haben "Das Tagebuch der Anne Frank" (bis heute eines der wichtigsten literarischen Dokumente über die NS-Zeit) adaptiert und damit ein originäres Kunstwerk entstehen lassen. Denn das Graphic Diary besticht einerseits durch das gewissenhafte Naheverhältnis zum Original-text – so wurden ganze Textseiten unverändert abgedruckt – und der bildästhetischen Interpretation andererseits: Annes Phasen der Depression und Verzweiflung haben wir in den meisten Fällen zu Fantasieszenen verarbeitet. Diese Tag- und Nachttraumdarstellungen heben sich von der sequenzierten Erzählstrategie, die etwa Annes Momente der Langeweile ins Bild setzt, deutlich in Form von großformatigen, teils Doppelseiten umfassenden Bildern, ab. So wird Annes emotionale Innensicht ebenso eindrücklich illustriert wie die informative Außen-perspektive, die etwa das Hinterhaus und die Wohnraumauf-teilung der beiden versteckten Familien im Querschnitt ver-anschaulicht. Kein simpler Medientransfer, sondern eine ge-lungene Adaption, die es versteht, die Vielschichtigkeit Anne Franks auch in einem entsprechend vielschichtigen Bildprogramm einzufangen.
Aus d. Niederländ. v. Mirjam Pressler, Klaus Timmermann, Ulrike Wasel.
Fischer 2017.
160 S.
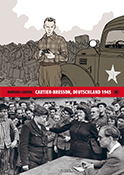
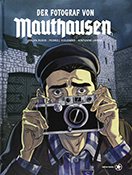
Jean-David Morvan / Sylvain Savoia / Séverine Tréfouell: Henri Cartier-Bresson, Deutschland 1945.
Henri Cartier-Bresson war ein leidenschaftlicher französischer Fotograf, dessen Bilder für ihre präzisen Kompositionen und den genauen Proportionen bekannt sind. Erste Aufmerksamkeit erlangte er mit seinen Fotografien des Spanischen Bürger*innen-kriegs, nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er mit drei weiteren Fotografenkollegen die Fotoagentur Magnum in New York. Weniger bekannt ist, dass er auch die Befreiung des KZ Dessau in Deutschland dokumentierte. Die vorliegende Graphic Novel fokussiert auf diesen Abschnitt und erzählt, was Cartier-Bresson selbst als Kriegsgefangener erleben musste. Ein ausdrucksstark illustrierter Ausschnitt der Zeitgeschichte über einen Fotografen, der später selbst Geschichte schrieb und dessen fotografische Suche nach dem „entscheidenden Augenblick“ vom politischen Geschehen ebenso wie dem Streben nach Freiheit geprägt war. Die historische Verortung der Befreiung sowie des Protagonisten selbst erfolgt in einem ausführlichen historischen Dossier, das der Graphic Novel nachgestellt ist
Aus d. Französ. v. Milena Merkac.
Bahoe Books 2020.
140 S.
Salva Rubio / Pedro J. Colobo / Aintzane Landa: Der Fotograf von Mauthausen.
Wie in der Graphic Novel über Henri Cartier-Bresson wird auch hier die Geschichte eines KZ-Häftlings geschildert: Der aus Katalonien stammende Francisco Boix war während des Zweiten Weltkrieges in Mauthausen inhaftiert und dem Lagerfotografen Paul Ricken unterstellt, der eine Vorliebe für die Ästhetik des Hässlichen hatte. Boix arbeitete in Mauthausen im Fotolabor bzw. auch als Rickens rechte Hand während der Entstehung tausender Fotografien. Im Zuge dessen wurden nicht nur Fotos zu Propagandazwecken geschossen und entwickelt, sondern auch die Gräueltaten der Nazis dokumentiert und tote Körper arrangiert, um die wirklichen Todesursachen der Insass*innen zu verschleiern. Alles, was nicht als Propaganda geeignet war, durfte aber nicht nach außen gelangen. Um dieser Vertuschung und Manipulation entgegenzuwirken, sammelte Boix Negative, die mithilfe von Mithäftlingen im Lager versteckt und hinaus-geschmuggelt wurden. Nach der Befreiung dienten rund 1000 dieser Negative als Beweismaterial für die Anklagen im Rahmen der Nürnberger Prozesse. Die Originalfotografien sind graphisch in die Panels der Graphic Novel eingearbeitet. Sie werden zudem im angehängten, ausführlichen Dossier aufgegriffen, das auch die Ereignisse rund um Boix nochmals historisch verortet.
Bahoe Books 2019.
176 S.
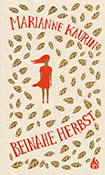

Marianne Kaurin: Beinahe Herbst.
Norwegen, 1942: Oslo soll nach und nach von Juden und Jüdinnen „gesäubert“ werden. Die Bücher-liebende Protagonistin Ilse Stern ist mit ihren 15 Jahren zum ersten Mal verliebt und ahnt noch nichts davon, dass sich ihr Leben und das ihrer Familie schon bald unwiderruflich ändern werde. Aus unterschiedlichen Perspektiven blickt der/die Lesende auf das Leben des Wider-standskämpfers Hermann (Ilses Schwarm), auf den ungewollten Deportationshelfer und Nachbarn von Familie Stern, auf Vater Isak, der längst alles Mögliche versucht, seine Familie vor dem wachsenden Judenhass in der Stadt zu beschützen und auf die beiden Schwestern Ilse und Sonja, die noch jugendliche Träume von ihrem Leben haben. Dabei werden nicht nur die zunehmende Unsicherheit und Angst thematisiert, sondern auch deren direkte Auswirkungen auf das Leben der Figuren. Unverblümt schildert Marianne Kaurin zwar fiktiv, aber an die realen Ereignisse des Herbstes 1942 angelehnt, die Lebensumstände im okkupierten Norwegen und sensibilisiert dieserart einmal mehr für die unterschiedlichen Schicksale jüdischer Menschen unter der Herrschaft der Nazis, von der erzwungenen Emigration bis hin zur Ermordung in Auschwitz.
Aus d. Norweg. v. Dagmar Missfeldt.
Arctis 2019. 224 S.
Wilma Geldof: Schweigen ist Verrat.
Ein packender Roman, erzählt in Ich-Form, der auf den Erinnerungen der 1925 geborenen Freddie Oversteegen beruht: Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Truus war sie ab 1941 als noch sehr junges Mädchen im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv. Die Autorin widersteht der Versuchung, daraus ein rein heroisches Narrativ zu entwickeln, sie gibt vielmehr den inneren Kämpfen und Gewissensnöten der beiden viel Raum, die immer größer werden, je radikaler die Taten sind, an denen sie sich beteiligen. (…) ich glaube nicht, dass ein Mensch jemanden töten kann, ohne sich selbst dabei zu verändern. (S.241) Das sagt eine großmütterliche Freundin zu Freddie und benennt damit das moralische Dilemma, mit dem diese immer wieder hadert: Ist es legitim, im Dienst der guten Sache jemand anderem das Recht zu leben abzusprechen? Gleichzeitig zehrt auch die ständige Angst um die eigene Unversehrtheit an ihr. Ungeschönt und drastisch berichtet Freddie von einem Alltag im Ausnahmezustand, von Hunger und zunehmender psychischer und physischer Erschöpfung. In einem kurzen Nachwort leuchtet die Autorin den biographischen Hintergrund aus und spricht an, dass Freddie und ihre Schwester erst 2014 von der niederländischen Regierung für ihren Einsatz ausgezeichnet wurden – davor galten sie als „Kommunistinnen“ als staatsgefährdend.
Aus d. Niederländ. v. Verena Kiefer.
Gerstenberg 2020.
343 S.


Monica Hesse: Sie mussten nach links gehen.
Die US-amerikanische Autorin Monica Hesse widmet sich der Zeit unmittelbar nach Kriegsende: Zofia, die 18-jährige polnische Ich-Erzählerin, sucht nach der Befreiung aus dem KZ Groß-Rosen nach ihrem jüngeren Bruder Abek, der Einzige aus ihrer Familie, von dem sie weiß, dass er an der Rampe in Auschwitz nicht nach links, also direkt in die Gaskammer, gehen musste. Diese Suche führt sie in ein deutsches Camp für Displaced Persons: Ein Ort, an dem junge Juden und Jüdinnen Pläne für ihre Zukunft schmieden. Zofias Familie hatte eine Textilfabrik, sie kann gut sticken und nähte lieben Menschen gerne heimlich Botschaften ein: So ist in jenen Mantel, den ihr Bruder bei der Deportation trug, ein kleines Stoffstück mit einem Alphabet der Familie eingenäht. Dieses Alphabet, das einen haptischen Aspekt der Weitergabe von Tradition ebenso beinhaltet wie einen intellektuellen, wird zum Leitmotiv des spannend erzählten Romans, der die Unklarheit, was nun tatsächlich mit Abek passiert ist, fast thrillermäßig einzusetzen weiß. Zofia bleibt die schmerzhafte Erkenntnis, dass jenes ursprünglich gestickte Alphabet einer Familie, die nicht mehr existiert, für immer verloren ist. Es liegt an ihr, ein neues Alphabet zu schreiben – zusammengesetzt aus all jenen Menschen und Orten, die ihr im Leben danach heilsam begegnet sind.
Aus dem Amerikan. v. Cornelia Stoll.
cbj 2020.
448 S.
Sharon Cameron: Das Mädchen, das ein Stück Welt rettete.
Stefania zieht Ende der 1930er-Jahre aus einem kleinen Dorf in Polen nach Przemysl, um dort in einem jüdischen Geschäft zu arbeiten. Das sechzehnjährige Mädchen aus einfachen Verhältnissen ist offen und vorurteilsfrei und freundet sich rasch mit der Familie Diamant an. Als die deutschen Truppen in Polen einmarschieren, wird die Familie ins Ghetto deportiert. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester versorgt Stefania die Diamants heimlich mit dem Nötigsten. Als ein Teil der Familie ermordet wird, trifft sie eine mutige Entscheidung: Sie versteckt Max, den Sohn der Diamants, und zwölf weitere Jüdinnen und Juden.Sharon Cameron erzählt in ihrem detaillierten Roman die bemerkenswerte Lebensgeschichte von Stefania Podgórska, die gemeinsam mit ihrer Schwester Helena 1979 von Yad Vashemals Gerechten unter den Völkern geehrt wurde. Dort wo dramaturgisch verknappt oder verändert wurde, legt die Autorin dies gewissenhaft im Nachwort offen. Ein Glossar hilft dabei, die zahlreichen Informationen zu überschauen und bietet so Einblick in den realen Hintergrund einer erstaunlichen Heldin, deren Mitgefühl und Hingabe jede Ehre und Erinnerung verdient.
Aus d. Amerikan. v. Katharina Förs, Naemi Schuhmacher.
Insel 2020.
473 S.


Jessica Bab Bonde und Peter Bergting: Bald sind wir wieder zu Hause.
Diese Graphic Novel widmet sich nicht einem Einzelschicksal, sondern versammelt das Leben von sechs Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Teilen der Erde, die unter nationalsozialistischer Herrschaft standen, wie Deutschland, Schweden oder Transsilvanien. Sie alle mussten während des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen und wurden in verschiedene Konzentrationslager deportiert. In voneinander entkoppelten Erzählungen wird auf Text-, vor allem aber auf Bildebene das Unvorstellbare zu Papier gebracht. Der Illustrator Peter Berting schreckt dabei nicht vor Szenen voll Leid, Schrecken und Tod zurück, bleibt im Erzählton aber nüchtern. Die konsequent kindliche Perspektive und die unterschiedlichen Schauplätze ermöglichen einen vielschichtigen Blick auf ein Stück Zeitgeschichte. Ein angehängtes Glossar vermittelt auch jüngeren Leser*innen wichtige Begrifflichkeiten rund um die Shoah. Der Hoffnungsschimmer dabei ist, dass alle sechs Kinder überlebten, sie alle sind als Zeitzeug*innen aktiv und leisten mit diesem Buch und darüber hinaus wichtige Aufklärungsarbeit für nachfolgende Generationen.
Aus d. Schwed. v. Monja Reichert.
Cross Cult 2020.
108 S.
Jean-Claude Grumberg: Das kostbarste alle Güter.
Deportationen. Unzählige Züge durchqueren einen Wald auf dem Weg zu den Gaskammern und Krematorien der Konzentrationslager. In diesem Wald lebt eine arme Holzfällersfrau mit ihrem Mann: in einem der Züge hingegen befindet sich ein verzweifelter Vater, der einem seiner Kinder das Leben rettet, indem er es aus dem fahrenden Gefährt wirft. Die Frau nimmt sich des kleinen Mädchens an und zieht es als ihre Tochter groß. Der Vater entrinnt den Gaskammern, fungiert als Friseur im KZ und überlebt bis zur Befreiung. Zwei Schicksale, vielleicht wahr, vielleicht nicht, werden in sehr poetischer Sprache auf das Nötigste heruntergebrochen, auf Hoffnung und Liebe hin ausgerichtet, ohne dabei die Grausamkeiten der Shoah zu verharmlosen. Auf zwei Erzählebenen wird in fast märchenhaftem Ton und in kurzen Kapiteln ein Abschnitt der Geschichte aufgearbeitet, in dem ein Kind zum „kostbarsten aller Güter” wird – zur Hoffnungsträgerin für die Holzfällersfrau ebenso wie für den inhaftierten Vater. Die eindringlichen und zugleich anrührenden, in Schwarz-Weiß gehaltenen Illustrationen von Ulrike Möltgen tragen zusätzlich zur besonderen Atmosphäre bei.
Mit Illustrat. v. Ulrike Möltgen. Aus d. Franz. v. Edmund Jacoby.
Jacoby & Stuart 2020.
128 S.
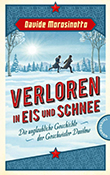
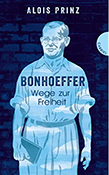
Davide Morosinotto: Verloren in Eis und Schnee. Die unglaubliche Geschichte der Geschwister Danilow.
Die Belagerung Leningrads vom September 1941 bis zum Januar 1945 durch deutsche und spanische Truppen kostete rund 1,1 Millionen Zivilist*innen das Leben. Am Beginn dieser Blockade verortet der italienische Autor seine Geschichte über die Zwillinge Nadja und Viktor, die aus Leningrad stammen und mit Zügen, die für die Evakuierung von Kindern bestimmt sind, die Stadt verlassen sollen. Doch sie werden getrennt. Anhand von zwei Erzählsträngen werden ihre Reisen und ihr Überleben nachgezeichnet. Dafür wählt der Autor eine Tagebuchform mit unterschiedlichen Schriftfarben: roter Buntstift für Viktor und blauer Kugelschreiber für Nadja. Aus einem zu Beginn kindlichen Erleben heraus wird von Gulags, Gefangenschaft, Tod und der Eiseskälte in Russland berichtet. Das Kindliche lassen beide Figuren schnell hinter sich, wenn es darum geht, das eigene Leben und das der Freund*innen zu retten, und wieder zueinander zu finden.
Morosinotto greift historische Tatsachen, wie etwa die Eroberung der Schlüsselburg, auf und verstrickt diese geschickt mit fiktiven Figuren und Ereignissen, in denen Kinder, durch den Krieg schnell erwachsen geworden, die Hauptrollen übernehmen. Der Text endet mit der Entdeckung der „Straße des Lebens”, einer Route auf dem Eis, über die Viktor nach Leningrad gelangt und Hilfe holt.
Aus d. Italien. v. Cornelia Panazacchi.
Thienemann 2018.
440 S.
Alois Prinz: Bonhoeffer. Wege zur Freiheit.
Vielen ist Dietrich Bonhoeffer durch seine Zeilen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ bekannt, die als Lied ungemein populär wurden. Seine historische Bedeutung liegt jedoch in seinem kompromisslosen Widerstand gegen das NS-Regime, den Alois Prinz als erfahrener Autor von Biographien hier ganz stark auf seine theologischen Überlegungen zurückführt. Diese gibt er auf faszinierend verständliche Weise wieder, ohne dabei ihre Komplexität zu verschweigen. So werden auch die bekannten Gedichtzeilen unprätentiös in den Kontext eines ganzen Lebens gestellt: Der Autor kommentiert den Text nicht, sondern berichtet nur nüchtern, wie Bonhoeffer diese Zeilen kurz vor Weihnachten einem Brief aus der Haft beigelegt hat. In seiner fundierten Auseinandersetzung mit Leben und Werk einer bemerkenswerten Persönlichkeit erhält letztlich auch der scheinbar widersprüchliche Untertitel des Buches einen Sinn. Auch wenn jemand, der nach zwei Jahren Gestapo-Haft kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde, weit von Freiheit entfernt zu sein scheint, liegt in seiner Geschichte doch eine Freiheit der anderen Art: „Das Recht zu leben wird zur Verantwortung für andere. Es wird zur Freiheit, auf dieses Recht für sich zu verzichten, um für den Nächsten, den ,Bruder Mensch‘, da zu sein.“
Gabriel 2017.
272 S.




